.jpg/300px-Stadtbild_Köln_(50MP).jpg) | ||
| Cologne | ||
| federal state | North Rhine-Westphalia | |
|---|---|---|
| Residents | 1.085.664 (2019) | |
| height | 52 m | |
| Tourist info | 49 (0)221 34 64 30 www.koelntourismus.de/ | |
| location | ||
| ||
Cologne is one of the oldest cities Germany. Its residents can look back on almost 2000 years of eventful city history. Kölle, as the locals affectionately call it, is the largest city North Rhine-Westphalia with a million inhabitants. It is the fourth largest city in the republic after Berlin, Hamburg and Munich. The city is best known for its Gothic cathedral, the top-fermented beer the local breweries, the quaint pubs in the old town, the Christopher Street Day with 1.2 million visitors (2019) and in the fifth season for the exuberant carnival.
Districts

Cologne is divided into 9 districts, which are divided into 86 districts. Within the districts, the people of Cologne usually still differentiate between different "Veedeln" (Kölsch for district). For example, the Martinsviertel, which people from Cologne understands as the old town, is part of the Altstadt-Nord district and part of the city center district.
- City Center (District 1) - Altstadt-Nord, Altstadt-Süd, Deutz, Neustadt-Nord and Neustadt-Süd
- Rodenkirchen (District 2) - Bayenthal, Godorf, Hahnwald, Immendorf, Marienburg, Meschenich, Raderberg, Raderthal, Rodenkirchen, Sürth, Rondorf, Weiß and Zollstock
- Lindenthal (District 3) - Braunsfeld, Junkersdorf, Klettenberg, Lindenthal, Lövenich, Müngersdorf, Sülz, Weiden and Widdersdorf
- Ehrenfeld (District 4) - Bickendorf, Bocklemünd / Mengenich, Ehrenfeld, Neuehrenfeld, Ossendorf and Vogelsang
- Trinkets (District 5) - Bilderstöckchen, Longerich, Mauenheim, Niehl, Nippes, Riehl and Weidenpesch
- Chorweiler (District 6) - Blumenberg, Chorweiler, Esch / Auweiler, Fühlingen, Heimersdorf, Lindweiler, Merkenich, Pesch, Roggendorf / Thenhoven, Seeberg, Volkhoven / Weiler and Worringen
- Porz (district 7) - Eil, Elsdorf, Ensen, Finkenberg, Gremberghoven, Grengel, Langel, Libur, Lind, Poll, Porz, Urbach, Wahn, Wahnheide, Westhoven, Zündorf
- Kalk (District 8) - Brück, Höhenberg, Humboldt / Gremberg, Kalk, Merheim, Neubrück, Ostheim, Rath / Heumar and Vingst
- Mülheim (district 9) - Buchforst, Buchheim, Dellbrück, Dünnwald, Flittard, Höhenhaus, Holweide, Mülheim and Stammheim
background
Not least shaped by the carnival, Cologne is a city with a cheerful and easy-going atmosphere. The residents are very proud of their city, their language and also their local beer, the Kölsch. You can do that with formulations like Wherever I feel is Kölle (Cologne is where we are). Other popular sayings like Et would still have joot jejange (it still went well) and Et kütt like et kütt (it comes as it comes) or läve un läve losse (live and let live) show a certain serenity and tolerance.
The joy of drinking has a long tradition. By 1830 there were still 360 breweries in Cologne. Today there are still 24 Kölsch brands, in contrast to the state capital Düsseldorf, where Altbier is drunk. This drink is frowned upon in Cologne. Here the top-fermented light Kölsch is drunk. In the vicinity of the wine-growing areas on the Middle Rhine and Ahr, there are also some wine bars.
Cologne is a city for living and working and celebrating. One often speaks of the "melting pot" Cologne, which is expressed in the fact that residents with a migrant background are also starting to use the Kölschen sproch. Migration has a long tradition in Cologne from the Romans to such apparently original Cologne residents as the inventor of the from Italy Eau de Cologne, Giovanni Maria Farina or the Milovic doll and actor family from the Balkans, which Germanized their name to Millowitsch.
Near the former capital Bonn Cologne is home to the secret service headquarters of the Office for the Protection of the Constitution, the Federal Administration Office and the radio house of the Deutschlandradios. Furthermore, Cologne is the seat of a district president, the Rhineland Regional Association, several courts and tax authorities.
The city is divided by the Rhine, with the left side being the historical center of the city Cologne is and is therefore seen by many Cologne residents as the "right" side, while the right bank of the Rhine with the district Deutz as peel sick referred to as. Deutz was incorporated in 1888, the other districts on the right bank of the Rhine only in the 20th century. Many tourist attractions are on the left bank of the Rhine, the one on the right bank in particular Cologne Exhibition Center and the Rheinpark of importance.
history
During the conquest of the area on the left bank of the Rhine by Caesar until 51 BC. became the in the area of Cologne and the Eifel Settling Germanic tribe of the Eburones crushed and largely exterminated. The flood-proof area of the later Roman city of Cologne was initially used as a provisional military base. A few years later the Roman legions were after Bonn and Neuss relocated and Cologne became the capital of the Ubier. The Ubier were a tribe allied with the Romans who originally lived in the area of the Westerwalds settled and around the year 38 BC. relocated to the abandoned area on the left bank of the Rhine. The later Cologne became the oppidum Ubiorum with a central shrine, the Macaw Ubiorum, of which no archaeological finds are known to date.
The Romans planned to expand the place after the conquest of Germania up to the Elbe to become the provincial capital of Germania. After the failure of further conquest plans, Cologne remained a border town. In the year 15 or 16 AD Agrippina was born in the city, later wife of the Roman emperor Claudius. They managed to make the city a veterans colony (Colonia) and to be raised as a city. As a thank you, the Ubians renamed themselves Agrippinensians. The settlement now promoted to the city was named Colonia Claudia Ara Agrippinensium (= Colony of Claudius, altar of the Agrippinensians). The road network was laid out in the usual rectangular shape. Some of the streets laid out back then are still clearly visible in the cityscape today.
In the year 85 AD. Cologne became provincial capital for the newly founded province of Lower Germany. This was followed by a heyday for the city, whose population is estimated at around 20,000. Among other things, the city was known for its pottery and glass production. Numerous large buildings were built, including the Praetorium, the provincial governor's palace. Part of the ruins can be viewed under the Spanish building of the Cologne City Hall. A trading port was built in the area of today's Martinsviertel. The free space of the Alter Markt and the Heumarkt are parts of the former harbor basin. A few pieces of wall still exist from the Roman city wall. An almost 120 km long aqueduct from the Eifel was built to supply the city with drinking water. Outside the city walls, not only handicraft businesses and inns were located, but the city's cemeteries were also located along the arteries. The forerunners of some Romanesque churches, such as St. Gereon, St. Ursula and St. Severin, were built in these cemeteries. It is unclear whether the first Cologne bishop's church was already on the site of today's cathedral.
Except for the headquarters of the Roman Rhine fleet in Cologne-Marienburg Cologne was a civil city, which was only to change in the 19th century. There were no larger barracks in Cologne for a period of around 1800 years, but there were on the other side of the Rhine. Under Emperor Constantine, the first wooden Rhine bridge in Cologne was built around 313. In order to secure the bridgehead on the right bank of the Rhine, it was built in the area of what is now the district Deutz the fort DivitiaIn December 355 the Franks conquered the city and largely burned it down. Even after the Roman conquest, only part of the city was rebuilt. At the beginning of the 5th century, the Roman era in Cologne finally ended, the city now became Franconian. Around the same time, the Rhine bridge became unusable and fell into disrepair, so that there was no fixed Rhine crossing in Cologne for more than 1,300 years.
Numerous archaeological finds from Roman times are in the Roman-Germanic Museum issued. Some objects were left at the place where they were found, e.g. the burial chamber in Cologne-Weiden or parts of the water pipe.In the Middle Ages, Cologne developed into one of the largest and most important cities in Europe. The city's history was shaped by the conflict between the archbishops and the citizens, which ultimately led to the free imperial city that was independent of the archbishop.
After the final conquest of Cologne by the Franks, Cologne - in contrast to Xanten or Neuss - by no means remained uninhabited. The Roman city wall was still intact or was repaired. The governor's palace could still be used, at least in part. For example, Pippin the Middle, grandfather of Charlemagne, resided in Cologne. However, it soon developed that the Frankish - and later also the German - kings of the Middle Ages did not have a permanent residence. They moved with their court from one of their royal castles, the so-called Pfalzen, to the next. The two palaces of the region were in Aachen and later also in Kaiserswerth north of Dusseldorf. Cologne was rarely visited by the kings; instead, the Cologne bishop became more and more influential in the city, the region and throughout the empire. At least since the Cologne bishop Kunibert (Bishop from 623-663) he was one of the king's most important advisors. Another bishop Hildebold (782-818) was even more important. Hildebold was a close advisor to Charlemagne and together they achieved the promotion of the diocese of Cologne to Archdiocese (795), which thus had the ecclesiastical supervision over all of north-west Germany and the later Netherlands. Presumably Hildebold also laid the foundation stone for the construction of the Domswhich should be appropriate to an archbishopric. However, the consecration did not take place until 870. This cathedral was the forerunner of today's cathedral and with a length of 95 m would still be the largest church in Cologne. In 881 there was an attack by the Vikings on Cologne, which largely devastated the city and probably also the last remaining buildings made unusable from Roman times. In the centuries that followed, up to the Second World War, Cologne was spared the destruction of war. The century after Charlemagne was politically shaped by the dispute between his sons, grandchildren and other relatives for power in the Franconian Empire. Cologne once belonged to the East Franconian, then to the West Franconian or also to the Middle Franconian Empire. The later France developed from the West Franconian Empire, from East Franconian Germany, while the Middle Franconian Empire disappeared. After a few wars, Cologne belonged permanently to the East Franconian Empire from 925, so you could say that Cologne was German from 925.
The Franks were not a single tribe, but a kind of tribal alliance. Through the conquests of the neighboring countries, the diversity of the Germanic tribes within the empire grew. The king usually lacked the power to completely subjugate the tribes under his rule, as happened in England or France, for example. In the 9th and 10th centuries the system of small states typical of Germany developed: the individual tribes were subjects of their duke, who in turn was subject to the king if it seemed useful to him or if he was forced to do so. In addition to these tribal duchies, there were also independent cities (the so-called free imperial cities) and ecclesiastical areas where the ruler was not a count or duke, but the bishop. Community affairs were settled at Reichstag, which took place every few years. The seven electors (from küren = to choose) were responsible for the choice of the king. These were four of the most influential tribal princes and the three most important church officials, including the Archbishop of Cologne.
In 953 the then Cologne received Archbishop Bruno, a younger brother of King Otto I, from his brother the duchy of the then Duchy of Lorraine, which was only a small part of the present-day French region of Lorraine. This marked the beginning of the time when the Archbishop of Cologne was not only an ecclesiastical pastor, but also a secular ruler. As a secular ruler, the archbishop not only had tax sovereignty, but was also responsible for jurisdiction and mint sovereignty in his area. Of course, he had his own soldiers and was able to determine which village was granted city rights or where a market could be held. While the borders of the ecclesiastical Archdiocese of Cologne were undisputed, there were repeated disputes and wars with neighboring countries over secular territory. That is why the Archbishops of Cologne also built several castles to secure their power and borders. The castles in are well preserved to this day Erftstadt-Lechenich and Zons.
Bruno was also important for the growth of the city of Cologne. The merchant settlement in the area of the Roman Rhine port was incorporated into the city by him by surrounding it with walls in the north and south and a church, Great St. Martin, built. This quarter was later named after her Martinsviertel, today often promoting tourism as Old town titled. But his favorite church was St. Pantaleon, at that time still outside the city. He converted it into Cologne's first Benedictine monastery and financed the expansion with generous donations. Not only Bruno was buried in St. Pantaleon, but also his brother's daughter-in-law, Queen Theophanou, a niece of the Byzantine emperor.The next important Archbishop of Cologne was Heribert (999-1021), also again a close advisor to the king. Since then, the Archbishop of Cologne has been the royal commissioner for Italy, which partly also belonged to the then German Empire. He also founded a monastery, but this time on the opposite side of the Rhine, in the fishing and ferry village of Deutz. After his death the monastery was named after him. Heribert's successor, Pilgrim, achieved that the right to coronate the German king fell to the Archbishop of Cologne - so the competing archbishops of Mainz and Trier moved into the second row.
Archbishop Anno (1056-1075) played a prominent role in the power disputes of the German princes. He was one of the main actors in the disputes at the time about the papacy with deposition and counter-popes. In 1062, with the support of some other princes, he kidnapped the then ten-year-old King Heinrich IV of Kaiserswerth to Cologne and was in fact regent of the German Empire until 1065. His growing power became uncanny to the other princes and so he was gradually disempowered. As he primarily acted as a secular ruler and made ruthless use of his power, there was a first uprising of Cologne merchants against the archbishop in 1074. This uprising could be put down militarily after a short time, but it was the first sign of the city's increasingly influential and self-confident bourgeoisie. A clear signal for the conflict between the archbishop and the city is that after his death he was not in Cologne Cathedral, but in the abbey he founded in Siegburg was buried.
In 1096 there was a first pogrom at the Jewish community in Cologne, whose synagogue was destroyed in the process. The archbishop of Cologne at the time took the Jews under his protection and partially settled them in other places in his area. The Jewish quarter near the town hall was later rebuilt. Another pogrom occurred during the plague epidemic in 1349. From 1372 Jews were allowed to live in Cologne again, but the city council finally revoked this permission in 1424.
The struggle for the independence of Cologne citizens against the archbishop as lord of the city continued to grow. When the citizens took the side of their father in the dispute over royal dignity between Henry IV and his son and also housed his father for some time in the city, in 1106 he gave the citizens military sovereignty, i.e. the right of their own defense, as a thank you. This means that the archbishop as sovereign was no longer responsible for the formation of soldiers, but also for the fortification of the city, but the citizens. These also showed the bishop who was in charge by surrounding three settlements bordering the Roman city wall with ramparts and moats and thus effectively incorporated. Around 1112, the forerunner of the Cologne city council, the oath association, came into being. A little later a land register was opened by the city, which recorded and regulated the property within the city. There was also a first town hall by 1139 at the latest - all steps on the way to more independence from the archbishopric rule. The importance of Cologne merchants can also be seen in the fact that in 1157 in London the Stalhof was built. This was a permanent building as a warehouse for the Cologne long-distance merchants and became the nucleus of the Hanse, which Cologne was a founding member and one of the most important Hanseatic cities.
In 1159 Reinald von Dassel was elected Archbishop of Cologne. During his eight-year tenure, he was in Cologne only once for a little over a year, most of the time he was busy with his duties in Italy. But that was precisely what was to become very important for the further history of Cologne: As part of a punitive expedition against the cities of northern Italy, he took the bones of the Three Wise Men with him as spoils of war from Milan to Cologne, where they have found their retirement home in the cathedral to this day. From 1180 onwards, the gold sarcophagus, which is still preserved today, was created for them. The transfer of these relics made Cologne from an important trading and craft town to one of the most important pilgrimage sites of the Middle Ages. In accordance with his abundance of power, Reinald had a palace built south of the cathedral in 1163, which was only demolished in 1674 due to dilapidation. His successor Philipp von Heinsberg (1167-1191) was initially a close advisor and friend of the emperor. As a thank you for his support, he was given the Duchy of Westphalia as a gift. Nevertheless, there was a dispute between him and the emperor. That is why he promoted the desire of the citizens of Cologne for a city wall that should not only encompass the parts immediately adjacent to the Roman wall, but also the rich monasteries and monasteries located slightly outside. Construction of this began in 1180 city wallwhich became the largest city wall in Europe. It led around the city in a semicircle. As a sign of the city's self-image, the wall was given twelve gates like the heavenly Jerusalem, although six or seven gates would have been enough for traffic. A smaller wall was built on the less endangered side of the Rhine, which was equipped with numerous smaller gates. Philip's sarcophagus in a side chapel of the cathedral is easy to recognize: it is adorned with walls and turrets.
The next important archbishop for the city's history is Engelbert von Berg. He became provost of Cologne cathedral as early as 1199 at the age of 14. At the same time, there were violent disputes about the royal dignity, in which the archbishops of the time also interfered. These disputes led, among other things, to a siege of the city and the removal of the Archbishop of Cologne. Finally, Engelbert was elected as the new archbishop as a compromise candidate by the emperor and the pope in 1215. Like all his predecessors and successors, he was opposed to the strivings for freedom of the citizens of Cologne. Important was his consolidation of the Cologne rule in Westphalia, where he granted city rights to numerous cities in the Bergisches Land and Sauerland. His policy, which made the archbishopric the most powerful country in the west of the empire, led to his assassination in 1225 Gevelsberg by a group of regional princes. The leader of this plot, Heinrich von Isenburg, was executed a year later in front of the walls of the city of Cologne. Contrary to the will of the Cologne clergy, Engelbert settled the two newly formed mendicant orders of the Dominicans and Franciscans in Cologne. These branches of the order later formed one of the roots of Cologne University. The Dominicans soon expanded their Cologne monastery into a religious college, at which from 1248 until his death in 1280 Albertus Magnus taught.
The next but one successor to Engelbert as Archbishop of Cologne was Konrad von Hochstaden from 1238-1261. He also tried to increase the influence of the archdiocese. Although he succeeded in Westphalia and on the Lower Rhine, after legal and military disputes with the citizens within Cologne he had to be satisfied with a compromise negotiated by Albert Magnus, in which the citizens could expand their self-administration. Subsequently, Konrad tried to divide the citizens by playing off craftsmen and city nobility against each other, which he only succeeded in the short term. It is also important of Konrad's rule that he laid the foundation stone on August 15, 1248 in the presence of his favorite anti-king, Wilhelm of Holland Construction of the Gothic cathedral began.
Konrad's successor Engelbert von Falkenburg (1261-1274) continued the power struggles of his predecessor with the citizens of Cologne. In December 1263 he was held in custody by the citizens of Cologne for three weeks; a two-week siege of the city in 1265 was unsuccessful. Engelbert finally gave up and moved his residence to it Bonn. However, soon afterwards he spent four years in the dungeon of Niedeggen Castle as a prisoner for Count von Jülich. During this time there was a conflict between two influential Cologne noble families, the Wise and the Overstolz. The Overstolz succeeded in driving the wise men out of the city, but they sought support from two supporters of the imprisoned archbishop, the Duke of Limburg and the Count of Kleve. A raiding party tried to dig under the city wall in October 1268 with the help of a shoemaker who lived by the wall and to open the city gates for the army. But the plan was discovered and foiled after a violent struggle. One attached about 100 years later Memorial plaque can still be seen today near the Ulrepforte and represents one of the oldest secular monuments in Germany.
The dispute between the citizenry and the archbishop culminated under the rule of Engelbert's successor, Siegfried von Westerburg (1274-1297). The occasion was the construction of an archiepiscopal castle in Worringen, downstream of the Rhine. This castle was not only intended to intimidate the citizens of Cologne, but also serve to collect customs from shipping on the Rhine. Engelbert, however, had undertaken not to build any new castles near Cologne. In addition, there was the side of the legacy of the Duchy of Limburg. Almost all the princes of the Rhineland intervened in this. Some feared an increase in power for the Duke of Brabant, which would upset the balanced power structure. The others wanted to further curtail the power of the archbishop as the most powerful ruler of the region to date. Of course, the citizens of Cologne sided with the archbishop's opponents. On June 5, 1288 it came to the south of Worringen Battle of Worringen, one of the greatest knight battles of the Middle Ages in Germany. The archbishop's side lost the battle. The city of Cologne was now freed from archbishop rule, even if the nominal appointment as a free imperial city did not take place until 1475. From now on, the archbishop was only allowed to enter the city and his cathedral church under strict conditions: he had to register in advance, was only allowed to bring a small number of unarmed escorts and to affirm the freedom of the city. At the same time, the independence of the city led to the rise of two neighboring cities: Bonn was expanded to the seat of the archbishopric, the village Dusseldorf There was one last attempt by the archbishops to fight the citizens of Cologne in 1314: Archbishop Heinrich von Virneburg took advantage of the short-term power vacuum during a dispute over the election of a king, named the village of Deutz opposite the city, fortified it and raised it from there customs. But after it turned out that the archbishop had bet on the wrong candidate in the controversy over the throne, the Deutz walls had to be torn down again and the tariffs lifted.
What made the citizens of Cologne so powerful to successfully resist the archbishop despite his mostly good contact with the king was their wealth. This had several causes: One was the craft. Cologne was one of the leading places for cloth production, armory and handicrafts. Another was trading. Between Cologne and Bonn, the Rhine turns from the narrow Middle Rhine to the wide Lower Rhine. These different forms of the river required different types of ships in the Middle Ages. Seaworthy ships could also get from the mouth of the Rhine to Cologne, which promoted trade between Cologne merchants and England. The different types of ship required that all goods transported by ship had to be reloaded in Cologne. The Cologne merchants managed to do this early on Stack right to achieve, which the archbishop stipulated in writing in 1259. All goods unloaded in Cologne had to be offered to the citizens of Cologne for three days before they could be transported on. Foreign merchants were not allowed to bid during this time. This led to a de facto trade monopoly of the Cologne residents for trade between the Netherlands and England on the one hand and southern Germany on the other. In terms of urban planning, this trade led to the construction of several large warehouses and department stores near the Rhine. Except for the partially rebuilt Stack house and the GürzenichHowever, none of them has survived, which served not only as a ballroom but also as a department store. Medieval trade also included the twice-yearly trade fairs at which foreign merchants presented their goods - mainly from the textile sector. In order to facilitate trade, the interest ban was lifted during the trade fair, so loans could be taken out. A third economic factor was the right to coins, which was transferred from the archbishop to the city. Cologne had the right to mint its own coins, which were recognized as a standardized means of payment ("Kölner Mark") throughout Northern and Western Europe. Finally, the fourth important economic factor was the pilgrimages. The relics of the Three Kings made Cologne an important place of pilgrimage. Due to the extensive Roman burial grounds, there were also numerous bone finds that could be sold profitably as the bones of holy martyrs and packaged in appropriate vessels by local goldsmiths.
In the High and Late Middle Ages, Cologne, with around 40,000 inhabitants, was not only by far the largest city in Germany, but also the third largest city in Europe after Paris and London. The city university, which was founded from the religious colleges, also made the city one of the science centers of that time.In the 14th and 15th centuries, the city continued to grow, freed from episcopal rule. The generously dimensioned city wall left room for further growth. The city was spared from the then often raging large fires, which often enough destroyed a large part of the buildings in other cities Doms went ahead. In 1322 the eastern part, the choir, was completed and the cathedral could be consecrated. On this occasion, the Shrine of the Three Kings was finally transferred to the cathedral. The whole rest of the cathedral was still under construction and was to remain so for over 500 years. A temporary partition wall was therefore drawn in front of the choir so that worshipers and pilgrims could visit the cathedral despite the construction site. The city was governed by the council. This consisted almost without exception of members of the patricians, i.e. the Cologne city nobility, who were mainly active as merchants or earned their money with their property. The craftsmen, who also had a large share in Cologne's prosperity, understandably felt that they were disadvantaged. In 1370/71 there was an uprising of the largest craft guild, the weavers. This was bloodily suppressed, but the rule of the patrician families wavered.
In 1388 the council seized the opportunity and asked the Pope for approval University foundation. Not only the existing religious colleges helped, but also the departure of professors and students from two existing universities: the plague raged in Heidelberg and many members of the university there left the city. And in Paris there was a dispute among the professors as to which of the two incumbent popes should be supported. Bei der Universitätsgründung achtete der Papst darauf auch den Erzbischof nicht zu verärgern: Der Dompropst als ständiger Vertreter des Erzbischofs in der Stadt wurde Kanzler der Universität, hatte also die Aufsicht inne. Auch blieb das Prüfungswesen in den Händen der Kirche, obwohl die Universität eine städtische Gründung war. Die ersten Professoren kamen überwiegend aus Paris, die Schwerpunkte der Universität lagen bei den Rechtswissenschaften und der Philosophie.
Ein Streit innerhalb der Patrizier führte 1396 zur Übernahme der Herrschaft durch die Handwerker. Die neue Stadtverfassung blieb fast 400 Jahre in Kraft. Der Stadtrat bestand überwiegend aus den Vertretern der 22 Gaffeln. Die Gaffeln waren Zusammenschlüsse von Handwerkern, aber auch Kaufleuten − also eine Mischung aus Bruderschaft und Handwerkerverband. Ausgeschlossen von der Mitgliedschaft waren Kleriker, Angehörige "unreiner" Berufe, Knechte, Gesellen, Bettler, Nichtkatholiken und alle Frauen, egal welchen Standes. Der Rat wählte die zwei Bürgermeister. Die Ratsmitglieder wurden für ein Jahr entsandt, anschließend durften sie mindestens zwei Jahre nicht Mitglied des Rates sein. So wurde der starke Einfluss einzelner Personen eingegrenzt. Zur Verteidigung der Stadt gab es eine allgemeine Wehrpflicht aller männlichen Einwohner zwischen 18 und 70 Jahren. Sie übernahmen reihum die Wache auf den Stadtmauer und ihren Toren sowie in der Stadt, hatten also auch Polizeiaufgaben. Die erforderlichen Waffen wurden im Zeughaus aufbewahrt.Nach einem Brand des Vorgängerbaus wurde ab 1359 das town hall mitsamt dem 61 m hohen Ratshausturm neu errichtet. Nach dem Wiederaufbau der Nachkriegszeit bildet der Bau bis heute das Zentrum des Rathauses. Ein weiterer städtischer Bau außer Rathaus und Zeughaus war der Gürzenich, 1441-1447 als städtisches Festhaus und Kaufhaus errichtet. Gegenüber vom Zeughaus entstand etwas später die städtische Geschützgießerei, welche aber nicht mehr erhalten ist.
Der Rat achtete darauf, keine Konkurrenz innerhalb und außerhalb der Stadt zuzulassen. So blieb die Zahl der Handwerker in der Stadt begrenzt. Auch das vermeintliche Wachstum konkurrierender Städte in der Nachbarschaft wurde nicht geduldet. Das etwas rheinabwärts liegende rechtsrheinische Mülheim erhielt 1322 von seinem Landesherrn, dem Grafen von Berg, die Stadtrechte. 1417 erreichten die Kölner, dass die Stadtbefestigung niedergerissen werden musste, womit Mülheim als mittelalterliche Stadt nicht ernst genommen wurde. Als einige Jahrzehnte später die Herzöge von Berg ihre Residenz von Schloss Burg an der Wupper an den Rhein verlegten, wählten sie Düsseldorf zur neuen Hauptstadt und nicht etwa Mülheim. Auch das zur Hälfte den Bergischen Grafen und zur Hälfte dem Erzbischof gehörende Deutz wurde argwöhnisch betrachtet. Jeder Versuch einer Befestigung und damit Aufwertung des Ortes wurde von den Kölnern verhindert. Doch siedelten sich in Deutz viele der 1424 aus Köln und Neuss vertriebenen Juden an. Der Erzbischof gab ihnen Schutz und profitierte von ihren Handelsgeschäften.
Im Gegensatz zu vielen anderen Freien Reichsstädten, wie z.B. Hamburg, Nürnberg, Ulm, Straßburg oder Rothenburg, gab es in Köln keine Bestrebungen, das Territorium durch Eroberungen oder Landkäufe zu erweitern. Das stadtkölnische Gebiet endete wenige Meter vor der Stadtmauer am Bischofsweg.Um 1500 begann der langsame Abstieg der Stadt. Dieser hatte mehrere Ursachen: Die alten mittelalterlichen Handelswege verlagerten sich. Es begann die Ära des Überseehandels und da konnte Köln nicht mithalten, denn die neuen größeren Seeschiffe waren zu groß für den Rhein. Die Hanse war an ihrem Ende angelangt − der Stalhof in London wurde auf Drängen der englischen Wirtschaft geschlossen, die durch enge Handelsbeziehungen verbundene Stadt Bruges verlor ihre führende Rolle an Antwerp. Der Versuch, ein Kölner Kaufmannszentrum in Antwerpen zu bauen, endete mit einem großen finanziellen Verlust.
Auch die Reformation versetzte der Kölner Wirtschaft einen heftigen Schlag. Zwar blieb Köln katholisch − ein Reformationsversuch endete mit der Hinrichtung des aus Remscheid stammenden Predigers Adolf Clarenbach − aber die Wallfahrer blieben aus. Evangelische Christen unternahmen keine Wallfahrten für ihr Seelenheil und hielten nichts von Reliquien. Und auch in den katholischen Gebieten kamen diese Frömmigkeitsbräuche des Mittelalters so allmählich aus der Mode. Auch das Hauptexportgut der Kölner Handwerker, die Tuche und Textilien, verkauften sich nicht mehr so gut. Und schließlich hatte Köln nach dem erzwungenen Umzug des Erzbischofs nach Bonn keine Residenz. Es war und blieb eine Handwerker- und Bürgerstadt und hatte so keinen Anteil am allmählich entstehenden höfischen Leben. Es gab noch nicht einmal eine Kaiserpfalz, wie sie z.B. die Freie Reichsstadt Nürnberg hatte. Auch die mit den Fürstenschlössern verbundene Kultur ging an Köln weitgehend vorbei. In Köln lebten in dieser Zeit keine bekannten Maler, Komponisten oder Schriftsteller. Sie lebten und arbeiteten an den Fürstenhöfen, aber nicht in der eher rückständig scheinenden Stadt Köln. Die einzige Ausnahme war der Maler Peter Paul Rubens, der sich Mitte des 16. Jahrhunderts für einige Jahre in Köln aufhielt. In der Kirche St. Peter hängt immer noch das von ihm gemalte Altarbild.
Ein Zeichen für den Abstieg Kölns im 16. bis 18. Jahrhundert ist, dass es in der Stadt zwar viele romanische und gotische Kirchenbauten gibt, aber nur sehr wenige barocke Kirchen. Einige Kirchen bekamen zwar eine barockisierte Innenausstattung, aber diese wurde im 19. Jahrhundert oder beim Wiederaufbau nach der Kriegszerstörung weitgehend entfernt. Auch der Bau des Doms ging immer langsamer voran und wurde 1560 schließlich ganz eingestellt, da dem Domkapitel als Bauherr das Geld ausging und man wohl auch keinen dringenden Bedarf mehr sah, dieses "altmodische" Riesenprojekt fortzuführen. Der Erzbischof kam aus bekannten Gründen sowieso nur selten vorbei, um in seiner Bischofskathedrale die Messe zu lesen. Fast 300 Jahre blieb der arbeitslose Kran auf dem unvollendeten Turm stehen.
Da Köln von der Reformation Abstand hielt, hatte die Gegenreformation hier eines ihrer Zentren. Die Universität stand fast geschlossen hinter dem Papst und die Jesuiten bauten mit St. Maria Himmelfahrt (neben dem Hauptbahnhof) eine große neue Kirche in der Nähe des Doms und des damaligen Universitätsviertels. Die mit der Reformation verbundenen Kriege halfen Köln sogar, indem sie der aufstrebenden Konkurrenz schadete: Der Ort Deutz wurde zerstört, was die Kölner freute. Und auch Mülheim musste auf Drängen Kölns seine Mauern und seine Stadterweiterung abreissen. Der Dreißigjährige Krieg schließlich wurde von den Kölnern mit umfangreichen Zahlungen an die kriegführenden Parteien von der Stadt ferngehalten. Gleichzeitig blühte in Köln letztmals das Waffenschmiede- und Geschützgießerhandwerk. Die chaotische Lage nach dem Dreißigjährigen Krieg veranlasste den Rat, im Jahr 1660 bezahlte Stadtsoldaten einzuführen. Sie sollten die Tore kontrollieren und herumziehende Räuberbanden und ähnliches abschrecken. Diese Soldaten bekamen im Volksmund den Namen Funken. Die Erinnerung an sie wird in einigen Karnevalsgesellschaften wachgehalten, auch wenn diese Uniformen aus preußischer Zeit stammen. Köln blieb zwar eine der größten Städte des Reiches, aber andere Städte wie Hamburg, Nürnberg und Augsburg holten auf und zogen schließlich vorbei. Während Köln um 1500 noch etwa doppelt so viele Einwohner wie Hamburg hatte, war es um 1700 genau umgekehrt. Die Einwohnerzahl Kölns von ca 40.000 blieb zwischen 1400 und 1800 etwa konstant. Erst um 1850 wurde die großzügig gebaute Stadtmauer für das Wachstum der Stadt zu klein.
Der von den Handwerkern dominierte Stadtrat und die konservativ eingestellte Universität verhinderten weitgehend den Anschluss der Stadt an die Moderne. Köln trat für über 250 Jahre weitgehend auf der Stelle. Bis auf einige wenige Kirchenbauten, die Anpassung der Stadtmauern an die verbesserten Geschütze und geringfügige Erweiterungen des Rathauses tat sich in der Stadt baulich fast nichts. So wurde das erste Theater erst 1768 errichtet − als kostengünstiger Holzbau! Auch die ersten Fabrikanten waren in der Stadt unerwünscht, wenn sie überhaupt einen Platz für ihre Produktionsgebäude gefunden hätten. Um auswärtige Händler nicht all zu sehr zu verärgern, wurde zwar geduldet, dass Protestanten in der Stadt Wohnung nahmen, jedoch durften sie weder das Bürgerrecht erlangen noch Gottesdienste abhalten. Dazu mussten sie nach Frechen oder Mülheim gehen, bzw. rudern. Nur außerhalb der Stadtgrenze, also schon auf dem Gebiet des Erzbistums, war es den Protestanten möglich, ihre Toten zu bestatten. Dieser Friedhof, der Geusenfriedhof (Weyertal/Ecke Kepener Straße) war von 1576 bis 1829 in Nutzung und ist durchaus sehenswert. Die katholischen Bürger Kölns hingegen wurden, wie es in mittelalterlichen Städte üblich war, rund um ihre Pfarrkirche beigesetzt − bei vermögenden Bürgern auch in der Kirche. Heimat- und Ehrlose wurden auf dem Elendsfriedhof nahe der Severinstraße begraben, auf dem im 18. Jahrhundert als Spende einer niederländischen Flüchtlingsfamilie die Elendskirche St. Gregor (An St. Katharinen, Stadtbahnhaltestelle Severinstraße, Linien 3,4,17) errichtet wurde.Mit der Besetzung des Rheinlands durch die französische Revolutionsarmee im Oktober 1794 endete die Kölner Selbständigkeit. Ab 1797 gehörte Köln zu Frankreich, und zwar zum Departement Roer, zu dessen Hauptstadt das zentraler gelegene Aachen bestimmt wurde. Als französische Stadt bekam Köln zwangsläufig eine neue Verwaltungs- und Gerichtsordnung. Diese war so tauglich, dass sie auch nach der Franzosenzeit mit wenigen Änderungen beibehalten wurde. Um den Überblick in der Stadt zu erleichtern, wurde die Stadt in vier Quartiere aufgeteilt und die Häuser in jedem Quartier durchnummeriert. Das führte zu zahlreichen drei- und vierstelligen Hausnummern. Bekannt ist die Nummer des Wohnhauses eines Parfümherstellers an der Glockengasse, der nicht seinen Namen, sondern die Hausnummer 4711 auf seine Flakons schrieb. 1811 ging man zur besseren Übersicht dazu über, die Häuser straßenweise zu nummerieren, wie es auch heute der Fall ist. Diese Nummerierung ermöglichte auch den Druck des ersten Kölner Adressbuchs. Aus hygienischen Gründen wurde die Bestattung auf den alten Kirchhöfen untersagt, stattdessen wurde 1810 der neue Zentralfriedhof an der Straße nach Aachen eröffnet.
Die Klöster und Stifte wurden aufgelöst, der kirchliche Besitz beschlagnahmt. Große Teile der wertvollen Kunstwerke aus den Kirchen und städtischem Besitz wurden verkauft oder nach Paris transportiert. Die Pfarrgemeinden zogen aus ihren kleinen Pfarrkirchen in die großen und viel schöneren ehemaligen Stifts- und Klosterkirchen um, während die ehemaligen Pfarrkirchen abgerissen wurden. An einige erinnern noch Straßennamen oder − wie bei Klein St. Martin − der Kirchturm. Im Jahr 1801 wurde auch das Erzbistum Köln aufgehoben, stattdessen wurde ein Bistum Aachen eingeführt, zu dem Köln nun gehörte. Die Kölner Universität wurde ebenfalls geschlossen. Der letzte Rektor der Universität, Ferdinand Franz Wallraf, versuchte möglichst viele Kunstwerke und andere historisch wichtige Objekte für die Stadt zu erhalten. Er sammelte alles, was er kriegen konnte in seiner Wohnung. Eine weitere neue Errungenschaft für das katholische Köln war die Religionsfreiheit. Jetzt durften sich Protestanten und Juden in der Stadt niederlassen und ihre Gottesdienste abhalten. Für die evangelischen Gottesdienste wurde den Protestanten das ehemalige Antoniterkloster an der Schildergasse überlassen. Die kleine jüdische Gemeinde kaufte ein anderes ehemaliges Klostergelände an der Glockengasse. Mit großzügigen Spenden der Bankiersfamilie Oppenheim, welche ihren Wohnsitz von Bonn nach Köln verlegte, entstand dort 1861 die erste Kölner Synagoge nach 500 Jahren.
Kaum hatten die Kölner sich an die französische Herrschaft gewöhnt, war sie schon wieder zu Ende. Im Januar 1814 zogen die letzten französischen Soldaten ab, ihnen folgten die Preußen. Zunächst unterstellten sie die Stadt nur provisorisch ihrer Herrschaft, ab 1816 wurde es endgültig. Jedoch hielten die Preußen zu der größten Stadt ihrer neu erworbenen Rheinprovinz eine gewisse Distanz. Provinzhauptstadt wurde das etwa mittig gelegene Koblenz. Als Universität wurde weder die alte Kölner Universität noch die ehemalige Universität in Duisburg wieder eröffnet. Stattdessen wurden die leerstehenden Schlösser des Erzbischofs in Bonn für die neue gegründete Universität der Rheinprovinz genutzt. Nur der Appellationsgerichtshof als höchstes Provinzialgericht kam nach Köln. Heute ist daraus das Oberlandesgericht geworden. Etwas später wurde Köln wenigstens noch Sitz eines Regierungspräsidenten. Auch das Erzbistum Köln wurde 1821 wieder errichtet. Der Erzbischof musste gegenüber seinen Vorgänger aber große Abstriche bei seiner Residenz machen: Die Schlösser in Bonn und Brühl waren nun Staatsbesitz.
Ebenfalls verstaatlicht wurde die Kölner Stadtmauer. Sie wurde ausgebaut und mit weiteren Befestigungen im Vorfeld versehen. Eine Reihe von Forts etwa einen Kilometer vor der Stadtmauer ergab den inneren Festungsgürtel. Etwa 50 Jahre später wurde am Stadtrand ein weiterer Festungsgürtel errichtet. Köln war die größte Stadt Preußens auf der linken Rheinseite und man fürchtete französische Angriffe.
Recht bald begannen einige Baumaßnahmen durch den preußischen Staat: Zuerst wurden zwei Kasernen gebaut, eine am Neumarkt und eine zweite in Deutz. Beide stehen heute nicht mehr. Dann kam das Gerichtsgebäude am Appellhofplatz dazu, daneben entstand der Bau der Bezirksregierung. Endlich wurde an der Komödienstraße auch ein Theater gebaut. Die Stadt hingegen errichtete am Neumarkt das erste städtische Krankenhaus.Auch der wilde und ungezügelte Karneval wurde Objekt der preußischen Freude an Regelungen und Organisation. Die Bürger gründeten ein Festkomitee, welches ab 1823 die Organisation des Karnevals und seiner Umzüge in die Hand nahm.
The Weiterbau des Doms lag nicht nur daran, dass endlich wieder Geld in die verarmte Stadt floss. Gleichzeitig wurde der Dom auch zum Symbol eines deutschen Nationalgedankens, der vor allem gegen Frankreich zielte. Aus heutiger Sicht klingt dies besonders originell, da der gotische Stil in Frankreich deutlich vor Deutschland verwendet wurde. Jedenfalls sorgte diese Symbolkraft für reichlich Spendengelder von außerhalb. Am 4. September 1842 legte der preußische König Friedrich Wilhelm IV. den Grundstein zum Weiterbau des Doms. Den mittelalterlichen Plan für die Westfassade mit den beiden Türmen hatte man wiedergefunden, Nord- und Südseite sind Kreationen des 19. Jahrhunderts. Am 15. Oktober 1880 wurde die Fertigstellung des Doms gefeiert. Für vier Jahre war der Dom das höchste Bauwerk der Welt. Dennoch wurden die Dombaumeister bis heute nicht arbeitslos. Auch Steine halten nicht ewig, vor allem nicht mitten in einer Großstadt. Deshalb müssen immer wieder einige ausgetauscht werden
Auch der technische Fortschritt erreichte nun Köln: 1816 erschien das erste Dampfschiff auf dem Rhein. Um Nachrichten schneller nach Berlin zu schicken, wurde 1832 die optische Telegrafenlinie Berlin − Koblenz eröffnet. Zwei ihrer Türme befanden sich in Köln: Der eine im Vorort Flittard, der andere auf dem Turm von St. Pantaleon, damals im Besitz des preußischen Militärs. Aber schon nach 17 Jahren wurde die optische Telegrafie durch die elektrische abgelöst. The optische Telegraf in Flittard ist als technisches Denkmal erhalten geblieben.1839 fuhr der erste Eisenbahnzug von Köln nach Müngersdorf. In kurzer Zeit wurde die Strecke bis Aachen und dann weiter nach Belgien verlängert. Ziemlich schnell entstanden weitere Eisenbahnstrecken in alle Himmelsrichtungen. Die Bahnhöfe der ersten Eisenbahnlinien lagen außerhalb der Stadtmauer oder unmittelbar dahinter. 1859 wurde endlich die erste feste Rheinbrücke nach fast 1500 Jahren eröffnet, um die rechts- und linksrheinischen Bahnstrecken zu verbinden. Auf Wunsch des Königs lag sie in einer direkten Linie zum Dom. Der einzig freie Platz in der Innenstadt, der botanische Garten der ehemaligen Universität, wurde zum Standort des neuen Hauptbahnhofs. Der Neubau von 1894 befindet sich noch immer an dieser Stelle.
Die ersten Fabriken hatten das Problem, dass innerhalb der Stadtmauern kein Platz für größere Industrieansiedlungen war: 1864 eröffnete Nikolaus August Otto zwar in der Innenstadt seine Motorenfabrik, doch zog er schon 1872 au die andere Rheinseite nach Deutz, wo er seinen Viertaktmotor fortentwickelte. Die Motorenfabrik erhielt dort den Namen des Stadtteils und prägte über mehr als ein Jahrhundert den Stadtteil. Das sehenswerte Motorenmuseum der Deutz AG ist leider nur auf Voranmeldung für Gruppen zugänglich. Ähnlich war es mit dem 1826 gegründeten Kabelhersteller Felten & Guilleaume, der aus der engen Innenstadt nach Mülheim auszog. Nur die Bonbon- und Schokoladenfabrikanten Stollwerck blieben im Severinsviertel. Andere im 19. Jahrhundert gegründete Industriebetriebe ließen sich gleich in den Vororten nieder, vor allem in Ehrenfeld, Bayenthal, Deutz, Mülheim, Kalk und Nippes. Der Versuch, die heimische Industrie mit vor Ort geförderter Braunkohle zu versorgen, schlug allerdings fehl: Das Bergwerk der Gewerkschaft Neu-Deutz hate gegen das vom Rhein gespeiste Grundwasser keine Chance und wurde schnell wieder aufgegeben. In die Betriebsanlagen zog die Brauerei und Kornbrennerei Sünner, welche den Schacht als Brunnen nutzt.Für den steigenden Güterverkehr auf dem Rhein wurden der Rheinauhafen in der Südstadt und der Hafen in Deutz erbaut.
Sogar die Culture fand allmählich ihren Einzug nach Köln. 1845 entstand die Rheinische Musikschule, heute als Musikhochschule eine der größten Europas. 1872 wurde ein Neubau für Oper und Theater an der Glockengasse eröffnet, dem nur 30 Jahre später ein repräsentatives Opernhaus am Rudolfplatz folgte, dessen Ruine nach dem Krieg abgerissen wurde. Nach dem Tod von Ferdinand Franz Wallraf 1824 erbte die Stadt seine umfangreiche Kunstsammlung, die in ein museum überführt werden sollte. Großzügige Spenden des Kaufmanns Johann Heinrich Richartz ermöglichten 1855 den Bau eines eigenen Museumsgebäudes auf dem Gelände des ehemaligen Franziskanerklosters. Der Neubau am gleichen Ort nach dem Zweiten Weltkrieg beherbergt heute das 1887 gegründete Kunstgewerbemuseum. The Wallraf-Richartz-Museum hingegen bekam vor wenigen Jahren ein neues Gebäude zwischen Gürzenich und Rathaus. Auch andere Kölner Museen beruhen auf großzügigen Spenden: Der Domkapitular Alexander Schnütgen schenkte 1906 der Stadt seine Sammlung kirchlicher Kunst, welche als Museum Schnütgen heute in der ehemaligen Kirche St. Cäcilien am Neumarkt untergebracht ist. Der Forschungsreisende Wilhelm Joest überließ der Stadt seine völkerkundliche Sammlung und seine Schwester Adele und ihr Mann Eugen Rautenstrauch spendierten 1906 den Bau eines Museumsgebäudes am Ubierring. The Rautenstrauch-Joest-Museum zog 2010 an den Neumarkt, neben das Museum Schnütgen, die Volkshochschule und die Zentralbibliothek der Stadtbücherei. Auch das 1913 gegründete Museum für ostasiatische Kunst beruht auf Spenden und schließlich stiftete das Aachener Schokoladenherstellerehepaar Ludwig einen Teil seiner beachtlichen Sammlung von Kunst des 20. Jahrhunderts für ein nach ihnen benanntes Museum. Den Bau des Gebäudes musste allerdings die Stadt bezahlen. The Schokoladenmuseum am Rheinauhafen hingegen ist eine Spende des Stollwerck-Besitzers Heinz Imhoff.
Für die Erholung der Kölner wurde auch gesorgt: 1860 eröffnete im Vorort Riehl der zoo, 1864 wurde in direkter Nachbarschaft der neue Botanische Garten, die Flora, eröffnet. Das zentrale Haus mit einem großen Ballsaal wurde zum 150-jährigen Jubiläum renoviert und modernisiert.
Die Stadt hätte sich gerne vergrößert, aber die preußische Regierung wollte die Stadtmauer nicht wieder hergeben. Erst 1881 gelang es dem Stadtrat nach langen Verhandlungen, dem Staat die Mauer und das Gelände bis zum inneren Festungswall abzukaufen. Da die Mauer ursprünglich von der Stadt errichtet wurde und der preußische Staat sie 1816 schlichtweg beschlagnahmt hatte, ein sehr dubioser Kauf, der aber gut für die Staatsfinanzen war. Bis auf drei der großen Torburgen und einige kleinere Mauerstücke wurde die Stadtmauer abgebrochen. Vor die Mauer wurde ein ringförmiger Boulevard gelegt, daran anschließend entstand ein großes Wohnviertel nach weitgehend einheitlichem Plan − die Neustadt. An einigen Stellen der Neustadt wurden repräsentative Bauwerke errichtet. Schon 1888 wurden große Teile des linksrheinischen Umlands sowie Deutz und Poll eingemeindet. Nun konnte das planmäßige Wachstum der Stadt angegangen werden. Nur ein etwa 600 m breiter Streifen vor dem inneren Festungsgürtel musste zunächst als Schussfeld freigehalten werden. Weitere Eingemeindungen folgten: 1910 folgten Kalk und Vingst, 1914 dann Mülheim und viele kleine Dörfer im Rechtsrheinischen, wie Brück, Dünnwald, Flittard oder Dellbrück. Flächenmäßig war Köln nun die größte Stadt Deutschlands. 1922 schließlich wurde das Gebiet der Bürgermeisterei Worringen im linksrheinischen Norden zu Köln hinzugefügt.
Stadt und Vororte wurden durch die privat betriebene Pferdebahn verbunden. Im Jahr 1900 erwarb die Stadt die Pferdebahngesellschaft und baute die Strecken innerhalb weniger Jahre zur elektrischen tram out. Die schnell zu klein gewordene Rheinbrücke wurde 1906 durch eine zweite Eisenbahnbrücke, die Südbrücke, ergänzt und 1911 durch einen größeren Neubau, die Hohenzollernbrücke, ersetzt. 1915 wurde dann die nächste Brücke vom Heumarkt nach Deutz eröffnet.
Der Kaufmann Heinrich von Mevissen stiftete der Stadt den finanziellen Grundstock zur Gründung einer städtischen Handelshochschule. Sie wurde 1901 eröffnet und war die Wurzel für die neue Kölner Universität.
Der erste Weltkrieg führte zu zahlreichen Kriegstoten unter den einberufenen Bürgern. Einige britische Luftangriffe im Jahr 1918 führten zu den ersten Bombentoten in der Stadt. Die mangelhafte Versorgung der Zivilbevölkerung führte ab 1916 zu Hungersnöten, vor allem im Winter. Am 18. Oktober 1917 wurde Konrad Adenauer als Oberbürgermeister gewählt und blieb es bis 1933. Schon seit 1906 war er als Beigeordneter an einflussreicher Position in der Stadtverwaltung tätig.
Das Kriegsende im November 1918 brachte die Besetzung der Stadt durch britische und französische Truppen. Die Briten blieben für einige Jahre, um die entmilitarisierte Zone des linksrheinischen Deutschland zu überwachen.Die Weimarer Republik brachte zuerst eine große Wirtschaftskrise. Oberbürgermeister Adenauer versuchte die Massenarbeitslosigkeit mit Arbeitsbeschaffungsprogrammen zu lindern. Da im linksrheinischen Deutschland kein deutsches Militär sein durfte, waren auch die beiden Festungsgürtel überflüssig. Sie wurden in zwei Grüngürtel umgewandelt. Die dafür erforderlichen Anpflanzungen, die Anlage von Seen und Wegen und der Bau eines großen Sportzentrums in Müngersdorf, damals die größte Sportanlage Deutschlands, gaben vielen Arbeitslosen eine Beschäftigung und wenigstens einen knappen Lohn.
Bereits kurz nach Kriegsende und befreit von den Zwängen des Kaiserreichs wurde ausgehend von der Handelshochschule im Jahr 1919 die Kölner Universität eröffnet. Wieder war sie − wie schon die alte Universität − eine städtische Einrichtung. Erst 1953 wurde sie zu einer Landeseinrichtung. Zunächst hatte sie ihre Gebäude in der Südstadt, wo das Gebäude der Handelshochschule als Hauptgebäude diente. Heute ist die "Alte Uni" ein Teil der Technischen Hochschule. Die Stadt brachte ihr städtisches Krankenhaus, die Lindenburg in Lindenthal, als Universitätsklinik a. Weil die Zahl der Studenten stark anstieg, begann 1929 der Bau eines neuen Hauptgebäudes im Inneren Grüngürtel in Lindenthal. Die Eröffnung war mit Beginn des Wintersemesters 1934/35. Da dieses Gebäude im 2. Weltkrieg nicht zerstört wurde, diente es in den ersten Nachkriegsjahren auch als Ersatzspielstätte für die städtischen Bühnen.
Nach dem Ende der Wirtschaftskrise 1923/24 sorgte Adenauer für den weiteren Ausbau der Stadt. Eines der wichtigsten Projekte war der Bau eines Messegeländes im Norden von Deutz. Von 1922 bis 1928 entstanden Hallen mit einer Ausstellungsfläche von 66.000 m² sowie der bis heute das rechtsrheinische Panorama mitprägende Messeturm, in dem sich ein Restaurant mit toller Aussicht befindet. Da die alten Hallen für den heutigen Messebetrieb nicht mehr zeitgemäß waren, wurden die meisten umgebaut. Nur die denkmalgeschützte Außenfassade blieb bestehen, während im Innenraum Büros und die Zentrale des Fernsehsenders RTL Platz finden. Ein weiteres Bauwerk der Moderne war das Hansahochhaus am Hansaring, 1924/25 als das erste Hochhaus Kölns erbaut. Mit 64 m Höhe war es für wenige Monate das höchste Haus Europas. 1926 zog der Vorläufer des heutigen Westdeutschen Rundfunks nach Köln.Als Erweiterungsfläche für zukünftige Industrieansiedlungen und Wohngebiete betrieb Adenauer die Eingemeindung der Bürgermeisterei Worringen, welche ein großes Gebiet im linksrheinischen Norden umfasst. Herausragendes Beispiel für Adenauers Wirtschaftspolitik ist die Ansiedlung der deutschen Fordwerke in Köln-Niehl. Heute hat sich das Gelände mit einem Entwicklungszentrum und dem zentralen Ersatzteillager für Europa bis nach Merkenich und Feldkassel ausgeweitet.Für den beginnenden Luftverkehr wurde der Militärflugplatz bei Ossendorf umgewandelt. The Flugplatz Butzweilerhof war in den Jahren ab 1926 der wichtigste deutsche Flughafen nach Berlin-Tempelhof. Das 1936 eröffnete Empfangsgebäude wurde in den letzten Jahren restauriert. Geplant ist die Einrichtung eines Luftfahrt- und Technikmuseums. Flugbetrieb ist heute allerdings nicht mehr möglich, da der von 1939 bis 1995 militärisch genutzte Flugplatz mit einem Gewerbegebiet überbaut wurde.Die im 1914 geschlossenen Eingemeindungsvertrag mit Mülheim vereinbarte Rheinbrücke von Mülheim nach Riehl wurde 1929 endlich eröffnet. Damit erhielt die Stadt ihre vierte Rheinbrücke.
Auch die zweite große Wirtschaftskrise zu Beginn der 1930er Jahre versuchte Adenauer mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu überstehen. Bekannteste Maßnahme ist der Bau der ersten deutschen Autobahn zwischen Köln und Bonn, der heutigen A 555. Am 6. August 1932 wurde sie eröffnet, also ein halbes Jahr vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Das bedeutet, dass die Autobahn keine Erfindung der Nationalsozialisten war, wie es fälschlicherweise immer wieder behauptet wird. Auch die Idee, den Autobahnbau als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu nutzen, wurde von den Nazis nur übernommen, nicht aber erfunden.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Adenauer als Oberbürgermeister schon im März 1933 abgesetzt. Ähnlich wie die Preußen mochten auch die Nazis die Stadt nicht sehr, was auf Gegenliebe stieß: Bei den letzten teilweise freien Wahlen im März 1933 wurde die NSDAP nur zweitstärkste Partei nach dem Zentrum, der Partei Adenauers. Doch als eine der größten Städte des Reiches wurde sie trotzdem zur Gauhauptstadt befördert. Dazu gehörte nach dem nationalsozialistischen Empfinden auch eine breite Aufmarschstraße, um Märsche und Paraden mitten durch die Innenstadt vom Inneren Grüngürtel zum geplanten "Gauforum" in Deutz durchführen zu können. Also wurde eine breite Straßenschneise vom Rudolfplatz über den Neumarkt bis zum Heumarkt geschlagen. Für den innerstädtischen Verkehr, der sich einschließlich der Straßenbahn bis dahin durch die gewundenen mittelalterlichen Gassen quälte, sicherlich eine große Verbesserung. Für das Stadtbild eher weniger. Das stark heruntergekommene Martinsviertel wurde teilweise saniert, wobei viele der Bauten in den Hinterhöfen abgerissen wurden.Bei der Reichspogromnacht wurden die sechs Kölner Synagogen alle niedergebrannt. Nur die Synagoge an der Roonstraße wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut. Für die stark geschrumpfte jüdische Bevölkerung Kölns in der Nachkriegszeit reichte sie aus. Etwa 8.000 jüdische Einwohner Kölns wurden während der NS-Zeit ermordet. Erst der Zuzug von jüdischen Auswanderern aus der ehemaligen Sowjetunion ab den 1990er Jahren erforderte weitere Bauten.Auf dem Platz der ehemaligen Kölner Hauptsynagoge an der Glockengasse wurde von 1955-57 das neue Opern- und Schauspielhaus errichtet. Immerhin benannte man den davor entstandenen Platz nach dem jüdischen Kölner Komponisten Jakob (Jacques) Offenbach.
Im Zuge des Ausbaus der Autobahnen erhielt Köln mit der Autobahnbrücke in Rodenkirchen 1941 seine fünfte Rheinbrücke. Bei der Fertigstellung war es die größte Hängebrücke Europas, was aber während des Krieges keine große Beachtung fand. Doch wurde die Brücke schon 1945 zerstört. Beim Wiederaufbau 1952-54 wurden die noch intakten Pylone wiederverwendet.
in the Zweiten Weltkrieg wurde Köln zu einem häufigen Ziel der alliierten Bombenangriffe. Die Stadt war als bedeutender Verkehrsknotenpunkt und Industriestandort sowieso ein wichtiges Ziel. Außerdem lag sie deutlich näher an den Flugplätzen in England als beispielsweise Leipzig, Stuttgart, München oder Berlin. Am Ende des Krieges waren 95% der Häuser in der Innenstadt zerstört oder stark beschädigt, auch in den Vororten sah es nicht viel besser aus. Köln war die am stärksten zerstörte Großstadt Deutschlands. Von den 770.000 Einwohnern vor dem Krieg harrten noch 104.000 in der Stadt aus. Etwa 20.000 Einwohner kamen bei den Luftangriffen ums Leben, etwa genau so viele Soldaten aus der Stadt überlebten den Krieg nicht. Alle Rheinbrücken waren zerstört. Beim Bau von Bunkern für die Bevölkerung stieß man 1941 südöstlich vom Dom auf ein großes Mosaik aus der Römerzeit, vermutlich der Fußboden des Wohnzimmers einer römischen Villa. Während des Kriegs wurde das Mosaik mit Brettern geschützt, nach dem Krieg als provisorisches Museum genutzt. Schließlich eröffnete man über diesem Mosaik 1975 das Römisch-Germanische Museum.
Am 7. März 1945 besetzte die US-Armee das linksrheinische Köln. Bis zur Besetzung der rechtsrheinischen Gebiete dauerte es noch ein paar Wochen länger.Konrad Adenauer wurde wieder als Oberbürgermeister eingesetzt, aber schon nach fünf Monaten wieder entlassen. Von da an konzentrierte er sich mit fast 70 Jahren auf seine deutschland-politische Karriere.Laut der Aufteilung in Besatzungszonen gehörte Köln zur britischen Zone und wurde demzufolge dem 1946 gegründeten Bundesland Nordrhein-Westfalen zugeschlagen. Da Köln am Südrand des Landes lag und zudem so stark zerstört war, wurde Düsseldorf zur Landeshauptstadt erklärt.
Der Wiederaufbau der Stadt zog sich über viele Jahre hin. Der Trümmerschutt wurde auf Hügeln in den Grünflächen abgekippt. Wichtig war auch der Wiederaufbau der Brücken. Eine provisorische Holzbrücke reichte nicht aus und war weder für Straßen- noch Eisenbahnen geeignet. Die erste Brücke war die Südbrücke, welche für den Eisenbahnbetrieb schon im Mai 1946 eingleisig freigegeben wurde. Eine komplette Wiederherstellung erfolgte bis 1950. Im Mai 1948 wurden die ersten zwei Eisenbahngleise der Hohenzollernbrücke wieder hergestellt, die anderen zwei Gleise folgten bis 1959. Der Straßenteil der Brücke wurde nicht wieder aufgebaut, am Deutzer Ufer kann man noch einen Teil der Brückenrampe sehen. Im Oktober 1948 folgte mit der Deutzer Brücke die erste Brücke für den Straßenverkehr und die Straßenbahn. Die Mülheimer Brücke war 1951 wieder aufgebaut.Der immer mehr zunehmende Verkehr erforderte noch drei weitere Brücken: Die 1959 eröffnete Severinsbrücke für Autos und Straßenbahn war der erste Neubau nach dem Krieg. Zur Schließung des Kölner Autobahnrings wurde im Norden 1965 die Leverkusener Autobahnbrücke in Betrieb genommen. Die Zoobrücke ist der Autobahnzubringer aus dem rechtsrheinischen Umland, sie wurde 1966 eingeweiht. Später wurden drei der Brücken verbreitert, ein Neubau der Leverkusener Brücke ist in Planung. Weitere Rheinbrücken werden zwar immer wieder vorgeschlagen, aber es gibt derzeit keine konkreten Pläne.
Einige historische Bauten wurden wieder aufgebaut, wenn sie als erhaltenswert betrachtet wurden. Dazu gehörten beispielsweise die zwölf großen romanischen Kirchen der Innenstadt, deren Aufbau allerdings 40 Jahre dauerte. Andere Kirchen wurden zum Teil in moderner Form wieder errichtet (z.B. St. Mauritius) oder nicht wieder aufgebaut (z.B. St. Laurentius). Die Außenmauern von St. Alban neben dem Gürzenich wurden als Gedenkstätte für die Kriegstoten stehen gelassen. In dem ehemaligen Kirchenschiff befinden sich die Abgüsse der trauernden Eltern von Käthe Kollwitz. Neu St. Alban in der Neustadt (Gilbachstraße) wurde 1957/58 zu einem Großteil aus Trümmerziegeln erbaut. Auch der Gürzenich und das Rathaus wurden wieder errichtet. Der Hauptbahnhof behielt seine große Bahnsteighalle, aber das Empfangsgebäude ist ein Neubau. Der Dom wurde zwar auch von mehreren Bomben getroffen, doch der massive Bau überstand die Angriffe.
Der ehemalige Militärflugplatz in der Wahner Heide konnte ab 1956 auch für den zivilen Flugverkehr genutzt werden. Heute ist der Flughafen Köln-Bonn überwiegend ein Zivilflughafen, auch wenn dort immer noch die Flugbereitschaft der Luftwaffe stationiert ist. Als teilweise militärisch genutzter Flughafen gehört er zu den wenigen deutschen Flughäfen ohne Nachtflugverbot.
Für den Autoverkehr wurde eine mehrspurige, weitgehend kreuzungsfrei angelegte Straße in Nord-Süd-Richtung quer durch die Innenstadt gebaut. Heute gilt dieser Bau als eine der Bausünden der "autogerechten Stadt", wird aber dennoch fleißig genutzt. Die Pläne einer Stadtautobahn entlang des inneren Grüngürtels hingegen wurden gestrichen, auch wenn die Innere Kanalstraße in etwa die Breite und das Verkehrsaufkommen einer gut frequentierten Autobahn hat.
Im Zuge der Truppenstationierung der NATO zogen die Briten Mitte der 1950er Jahre weitgehend aus Köln ab, stattdessen gab es bis in die 1990er Jahre mehrere Kasernen der belgischen Armee. Nach dem Abzug der Belgier wurden diese Gelände als Wohn- oder Gewerbegebiete neu bebaut. Relikt der britischen Besatzungszeit ist die Anglikanische Kirche All Saints in Köln-Marienburg (Lindenallee).
Die Bevölkerungszahl in Köln wuchs und gleichzeitig stieg auch der Wunsch nach zeitgemäßem Wohnraum. Darum wurden ab den späten 1950er Jahren bis in die Gegenwart zahlreiche Neubausiedlungen am Stadtrand angelegt. Diese Viertel sind aber weder baugeschichtlich noch architektonisch besonders bemerkenswert. Um 1970 entstanden einige große Wohnhochhäuser am Rand der Innenstadt. Besonders ins Auge fallen das Herkules-Hochhaus in Neuehrenfeld mit seiner bunten Fassade (102 m), das Uni-Center (134 m, zum Teil Studentenwohnheim) in Köln Sülz und das Colonia-Hochhaus (147 m) am Rheinufer in Köln-Riehl, welches von 1973-76 das höchste deutsche Haus war.Nach dieser Bauphase wurden für etwa 25 Jahre fast keine Hochhäuser in Köln gebaut. Erst ab 2000 wurden wieder einige größere Bürobauten hochgezogen. Vor allem das höchste Kölner Haus, der Kölnturm (148 m) im Mediapark mit seiner reflektierenden Glasfassade fällt deutlich auf. Ebenfalls bemerkenswert ist die Nutzung des für den Frachtverkehr nicht mehr benötigten Rheinauhafens. Einige der alten Lagerhallen wurden umfunktioniert, andere Gebäude kamen neu hinzu, vor allem die drei Kranhäuser: Drei 62 m hohe Bauten mit Büros und Luxuswohnungen, die alten Hafenkränen nachempfunden wurden. Um dem Parkplatzbedarf Rechnung zu tragen, entstand eine mehr als 1 km lange Tiefgarage.
Zum 1.1.1975 kam es zur bis jetzt letzten Eingemeindung: Die Städte Porz und Wesseling sowie zahlreiche kleinere Orte im linksrheinischen Umland wurden Köln zugeschlagen. Damit war Köln Millionenstadt. Aber nur für anderthalb Jahre, denn die Stadt Wesseling konnte vor Gericht die Eingemeindung nach Köln rückgängig machen. Erst 2010 führte das stetige Bevölkerungswachstum wieder zum Überschreiten der Millionengrenze.getting there
By plane
The 1 Cologne Bonn Airport![]() (IATA: CGN) is connected to the city center by bus and train with ICE, Regional Express and S-Bahn (line S19). From the basement of airport terminal 2 it only takes about 10 minutes to get to the main train station platform 10 (subway Breslauer Platz is closer than the cathedral / main train station) at the tariff of a normal journey (KVB ticket 1b). Regional express trains can also be used with this. Get tickets beforehand! From 2017 there will be a discount on HandyTicket purchased with the KVB app!
(IATA: CGN) is connected to the city center by bus and train with ICE, Regional Express and S-Bahn (line S19). From the basement of airport terminal 2 it only takes about 10 minutes to get to the main train station platform 10 (subway Breslauer Platz is closer than the cathedral / main train station) at the tariff of a normal journey (KVB ticket 1b). Regional express trains can also be used with this. Get tickets beforehand! From 2017 there will be a discount on HandyTicket purchased with the KVB app!
By train

The 2 Central Station![]() The subway station Dom / Hbf is at the main exit and the cathedral side, the subway station Breslauer Platz / Hbf is at the S-Bahn platform and bus station.
The subway station Dom / Hbf is at the main exit and the cathedral side, the subway station Breslauer Platz / Hbf is at the S-Bahn platform and bus station.
Another important train station with IC / ICE connections is 3 Cologne Fair / Deutz The underground station Deutz Bf / Messe can be reached via the east exits of the 4 upper platforms. From the main station it can be reached via the footpath of the Hohenzollern Bridge or with all S-Bahn lines.
ICEs also stop at the Cologne / Bonn Airport train station, which is part of the Cologne city area. Regional train stations are also: Cologne-South, Cologne-Ehrenfeld, Cologne-West, Cologne-Porz and Cologne-Mülheim. Other train stations and stops are served by S-Bahn trains.
With the IC / ICE, Cologne is connected to all major cities without changing trains.
Flixtrain connects Cologne with, among others, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Münster, Osnabrück and Hamburg as well as with Hanover and Berlin.
There are Thalys connections from Paris, Brussels and Liège.
Significant regional traffic connections exist among others: in the north direction: Mönchengladbach, Düsseldorf, Neuss, Krefeld, Duisburg, Essen, Bochum, Münster and Wuppertal, in the east direction: Hagen, Dortmund, Siegen and Bielefeld, in the direction of travel south: Bonn, Koblenz, Mainz, Euskirchen and Trier, in the west direction: Aachen
As one of the most important and largest hubs North Rhine-Westphalia Cologne is very well connected to the rail network. You can get abroad with the ICE (Amsterdam in 2 3/4 hours with the Thalys Paris in 3 1/4 hours and Brussels in just under 2 hours, Zurich with the EC in 6 hours (ICE with change 5'05 h), Vienna ICE in 9 1/2 hours (with (change 8 1/2 h). Off Frankfurt am Main you only need 1 1/4 hours.
The S-Bahn network is incomplete. So is Bonn not connected to the S-Bahn, but for example Bergisch Gladbach, Siegburg, Düren, Neuss and Dusseldorf. As a rule there is a twenty-minute cycle and on Sundays every half hour.
By bus
To reach the city of Cologne with Long-distance buses there are two long-distance bus stations, the Cologne-Süd long-distance bus station is on Cologne Bonn Airport, (Terminal 2) and the Cologne-North long-distance bus station in Leverkusen. National and international long-distance bus lines run here. Coming from downtown Cologne, the Cologne-North long-distance bus station is at Leverkusen Mitte station with the lines S 6, RE 1 and RE 5 and reachable, the Cologne-South long-distance bus station at Cologne / Bonn Airport is with the lines S 19, RE 6 and RB 27 reachable.
In the street
 | In Cologne were Environmental zones set up in accordance with the fine dust ordinance. Without a corresponding sticker, you risk a fine of € 80 when entering an environmental zone. This also applies to foreign road users. Entry ban for vehicles in pollutant groups 1 2 3 (Info Federal Environment Agency) |  |
The highways ![]()
![]() ,
, ![]()
![]() and
and ![]()
![]() form a motorway ring around the city of Cologne. Other motorways lead from the north (
form a motorway ring around the city of Cologne. Other motorways lead from the north (![]() left bank of the Rhine and
left bank of the Rhine and ![]() on the right bank of the Rhine) from the direction of Dusseldorf as well as from the south (
on the right bank of the Rhine) from the direction of Dusseldorf as well as from the south (![]() left bank of the Rhine and
left bank of the Rhine and ![]() on the right bank of the Rhine) from the direction of Bonn to the city.
on the right bank of the Rhine) from the direction of Bonn to the city.
The access roads (Venloer Strasse, Bonner Strasse, Neusser Strasse, Luxemburger Strasse, Aachener Strasse), the Rhine bridges, Rheinuferstrasse, the Cologne rings and canal roads and the north-south route are the arteries to the city center. However, they are overloaded, especially at rush hour.
There are parking garages all over the city center. These are also often overcrowded and quite expensive. There are cheaper parking opportunities in Cologne-Deutz at the exhibition center (on the right bank of the Rhine) or at the university. However, it is also difficult to get hold of a free parking space here.
Overall, at least during the day: Better to park outside and take the bus and train into town.
There are "Park and Ride" places from where you can take the train, e.g. in Hürth (along Luxemburger Str., Stop "Kiebitzweg" or "Hürth-Hermülheim", line 18), Cologne-Junkersdorf (Aachener Str. / Stadion, line 1), Cologne-Rodenkirchen (Militärringstrasse / Heinrich-Lübke-Ufer, line 16) or Cologne-Weiden (Bonnstrasse / Aachener Strasse, Weiden West, lines S12, S19 or line 1). With a valid VRS ticket, these parking spaces can be used for 24 hours at no additional cost (such as parking fees). Where buses and trains go and how to get to a good point to change trains by car can be found at the KVB AG Experienced.
Environmental zones have been set up in the city center since January 2008. Since July 1st, 2014 you can only enter with a green sticker. For more information, including how to purchase fine dust tickets, see Cologne environmental zone
By boat
The landing stages of the Rhine shipping companies are located directly in the access area of the city center on the Rhine. Different companies drive with River cruises the entire navigable Rhine from Rotterdam to Basel. Partial routes or a detour to the Moselle are also offered. The shorter journeys are interesting for day trips, e.g. to Bonn or to the Siebengebirge Koenigswinter. There are also round trips on the Rhine with a duration of one to two hours. Passenger navigation on the Rhine is almost non-existent in the winter months.
There is a passenger ferry from the old town to Deutz near the cathedral and at the exhibition center / Rheinpark. There is also another ferry for people and cars in the Langel (Merkenich) district in the north of Cologne. It runs daily from Langel across the Rhine to Leverkusen-Hitdorf.
By bicycle

- Rhine cycle route, signposted as "Erlebnisweg Rheinschiene" on both sides of the Rhine in the Rhineland. The Rhine Cycle Route is the main axis of national cycle tourism.
- BahnRadWeg - The 92 km long cycle route runs along the railway line from Aachen to Cologne. Warning: the route is no railway cycle path, but accompanies the railway line on dirt roads and back roads. Route information can be found on the website of the VCD district association Aachen-Düren to find.
- Rhine-Erft adventure route - From the Cologne Zoo Bridge through the Inner Green Belt Cheeky in the valley of the Erft.
On foot
- On the Roman Canal hiking trail, External website
- Way of St. James Metz-Cologne The Camino de Santiago from Metz to Cologne, about trier and the Eifel.
mobility


Public transport

The "Light rail" is a combined underground and tram. In the city center, the light rail trams run above ground on the east-west axis, from north to south and underground on the rings. Important central connection points are the stations Breslauer Platz / Hauptbahnhof and Dom / Hauptbahnhof, which enable you to change from long-distance and regional trains as well as S-Bahn to light rail traffic, as well as the Neumarkt (North-South / East-West change) and Rudolfplatz (change Rings / east-west). As part of the preliminary operation of the north-south light rail, a change in the direction of the main train station is already possible at the Heumarkt station.
The surrounding area can also be reached with the Cologne trams. Line 1 takes you to the Bergisch-Gladbach districts of Refrath and Bensberg (Bensberg - Refrath - Kalk - Deutz - Neumarkt - Rudolfplatz - Braunsfeld - Junkersdorf - Weiden). Line 4 leads to the Cologne city limits to Leverkusen - Schlebusch. Line 7 uses the tracks of the former Cologne-Frechen-Benzelrath Railway (KFBE) and leads to the suburb of Frechen (Zündorf - Porz - Poll - Deutz - Neumarkt - Rudolfplatz - Lindenthal - Marsdorf - Frechen). By far the longest tram lines of the KVB, lines 16 (via Wesseling) and 18 (via Hürth, Brühl and Bornheim), lead on two different routes to the former capital Bonn.
During the day (Monday to Saturday) from around 5 a.m. to 8 p.m. they run on most lines every 10 minutes, until around 12 a.m. every 15 minutes, and from around 12 a.m. until just after 1 a.m. at 30 -Minute cycle. Detailed information in Line map Cologne (PDF)On Sundays the trains run every 15 minutes until midnight, then every 30 minutes. On the nights before Saturdays, Sundays and public holidays, the trams run every 30 minutes, sometimes every 15-20 minutes. Some bus lines then also run every hour (sometimes every 30 minutes). Due to the high traffic in the inner city tunnel between the Appellhofplatz and Poststraße stations, there are more frequent traffic jams, the line speed of the trains is very low here. This will be remedied by the tunnel of the north-south light rail, which is currently being used from the north to the Heumarkt station and from the south to the Severinstrasse stop. Since the collapse pit of the Cologne City Archives is delaying the construction work between Heumarkt and Severinstrasse, the full opening of the route will only be possible in a few years.
Because the entire city center is built on Roman structures, building the subway in Cologne was more difficult than in other cities. When it came to building the underground, many criticized the fact that too little consideration was given to the Roman relics.
Important: It is not advisable to use line 1 (especially in the Deutz to Weiden section) when 1. FC Köln is playing, as the tracks are hopelessly overcrowded. Although special trams are used from Neumarkt on match days, the rush for the normal trams is also very large.
Bus routes complement tram traffic. You drive both in the city center, but especially in the suburbs. Some important bus lines have a similar schedule to the trains, but many run less frequently, i.e. only every 20 to 30 minutes on weekdays. However, the overlapping of several lines results in a 10-minute cycle on central sections.
Some supraregional bus lines connect Cologne with Solingen (line 250, from the bus station at Breslauer Platz), Remscheid and Wermelskirchen (line 260, from the bus station), Odenthal and Bergisch Gladbach (line 434, from Mülheim Wiener Platz), Hürth (line 978, from Bus station), Bergisch Gladbach-Bensberg (SB 40, from the bus station) and Bonn (SB 60, from Cologne / Bonn airport).
On bus routes outside Cologne (and Bonn) as well as on bus routes that are not operated by KVB (also within Cologne // almost always bus routes that do not belong to the 100 lines), the ticket must be shown to the bus driver or purchased when boarding become.
On some connections, the Train be a fast connection.
KVB tickets


The new ticket machines, which have now been installed by the KVB in most trains and buses as well as at many central stops, accept not only coins, but also EC cash and common credit cards. The machines generally do not accept banknotes. On lines 16 and 18, in addition to KVB vehicles, there are also trams operated by Stadtwerke Bonn, whose ticket machines generally only accept coins and debit cards.
The machine shown on the right belongs to the previous generation and is increasingly rare. Coins are ideal for paying with these devices, as these machines do not accept banknotes. Card payment is only with girocard possible, alternatively with cash card function.
Alternatively, you can use the ticket machines of Deutsche Bahn, where you can also buy KVB tickets (control panel -> VRS). Another possibility to pay with banknotes is the customer center or sales point (see below). Tickets for the urban area of Cologne (price level 1B) are also available from the TransRegio ticket machines; these also accept coins, banknotes, as well as EC and credit cards.
The older machines in the trams and buses also only partially accept EC cash. To add to the confusion, there are some machines that do not use a girocard, but only a cash card. The first strip of a strip ticket must be validated within the tram or bus.
There are generally no ticket machines installed in S-Bahn and regional trains. Here, the purchase and, if necessary, the validation must be made before starting the journey in front of or on the platform. However, normal single tickets and day tickets are already canceled when they are purchased (note the information on the screen of the ticket machine).
There is also the option of buying tickets online or by mobile phone ticket (when using the "DB Navigator", "VRS Information" or "KVB App" apps) Registration, 5% cheaper than conventional tickets (single tickets 10%). In addition, tickets can also be purchased in the Customer centers / Outlets can be bought (also with banknotes), for example at (H) Neumarkt, Dom / Hbf and Ebertplatz.
Fares
For any trip within Cologne's urban area, you need a city ticket from Stage 1b.
- A single ticket costs 3 €, children: 1.60 €
- 24 hour ticket for one person € 8.80. The ticket is valid for 24 hours after it has been validated.
- A week ticket (Mon-Sun) costs: € 27.20.
Further ticket options:
- 24 hour ticket 5 people. It costs € 13.40 and is valid for up to five people for one day in Cologne. The ticket is valid for 24 hours after it has been validated.
- Short haul tariff (Entry point 4 stops): € 2 (as of 01/01/2020).
- More information at the KVB or in their customer centers (e.g. Neumarkt, Dom / Hauptbahnhof or Ebertplatz)
Tickets bought online or via smartphone app are up to 10% cheaper!
Information on trips beyond the city is available from Verkehrsverbund Rhein-Sieg or in the Express transport plans. The website of the tells you which price level you need for which location or stop VRS ticket advisorThere is also an extra rail network map for tourists with information on places of interest (also in English and French): [1]The Deutsche Bahn app is ideal for planning trips within the city with a smartphone; she also knows bus traffic. The app of the Verkehrsverbund Rhein-Sieg VRS is a little more detailed and easy to use. Both apps are available for iOS (i.e. iPhone, iPad & Co.) and Android.
Bimmelbahn Schoko- and Zoo-Express
From the castle wall at the cathedral there are 2 departures every 30 minutes Tourist train lines to the chocolate museum and the zoo. The one-way ticket costs: 5 €, for children: 3 €, the return ticket: 9 €, for children 5 €.
Rhine cable car
From the end of March to the end of October, the Rhine can also be crossed by cable car. From above you have a great view of the Rhine panorama of the city center from a height of over 40 m. The station on the left bank of the Rhine is next to the zoo (tram line 18, Zoo stop), the station on the right bank of the Rhine in the Rheinpark next to the Zoobrücke and the "Claudius-Therme" thermal baths (bus lines 150, 250 and 260, thermal bath stop). The cabins have four seats and, depending on the number of people, run at short intervals of up to 20 seconds. Operating time is from 10 a.m. to 6 p.m., on some days of the year there are also evening and night trips. The trip is not possible in strong winds; the ticket costs € 4.50 for a single trip and € 6.50 for a return trip. Children up to the age of 12 travel at a reduced rate, schoolchildren, students, pensioners etc. unfortunately not. There are combined tickets with a visit to the zoo or for a tour: with the cable car over the Rhine, then a walk through the Rheinpark, over the Rhine back with the passenger ferry and then with the little train back to the zoo.
By bicycle
The bicycle is a popular means of transport for the city's residents. Most of the main roads have cycle paths that are relatively narrow compared to other cities and unfortunately not always in good condition. Visitors to the city are recommended to use the bike as an alternative to bus and train, especially when the weather is nice, especially along both banks of the Rhine.
For the Taking bicycles with you on public transport must be a additional ticket be solved. Bicycles can be taken along at peak times not recommended.
Cologne has a good network of Bike sharing-Bicycles that can be rented spontaneously and parked anywhere within the defined urban area. The leading provider is Deutsche Bahn with Call a bike. Every half hour costs € 1, the daily fee is € 15. In addition, there is an annual fee of € 3. Call a Bike members from other cities can also rent the bikes in Cologne. This service is not available in winter.
The provider is cheaper nextbike, also the bicycles under the name KVB bike confers. Here, 30 minutes cost € 1 each or € 9 for 24 hours. When registering for free, a starting credit of € 9 must be created.
The General German Bicycle Club (ADFC) offers one Bicycle city map for the cities of Cologne, Hürth, Frechen, Pulheim, Leverkusen and Bergisch Gladbach.
Park
Cologne is very cramped and parking spaces in the city center are rare. On the street, 20 minutes of parking time costs € 1.00, in the multi-storey car parks the hour costs € 1.70 - € 2.40. In the districts outside the city center, 50 cents per half hour are due on the street.
Car sharing
.jpg/220px-Koeln-Luftbild-2012-Cologne-aerial-view-bilderbuch-koeln_(cropped).jpg)
In Cologne there is a well-equipped network of car rental companies that operate after the Car sharing-Principle work, so different from conventional car rental companies. At Cambio and Quickest If you go to certain stations scattered across the city to rent a car, you usually have to bring the car back there. Daimler carried the most modern car-sharing variant with them Car2Go and BMW with Drive now in 2012 a. These specially marked vehicles can be found scattered across the city and can be rented spontaneously and parked anywhere within the defined city area. For the two providers, this affects large parts of the area on the left bank of the Rhine, but only the district of Deutz on the right bank of the Rhine. Such vehicles have not yet been found at the airport. The process pays off better for short distances than for longer ones. Example: After going to the cinema or the club at night, when the next train is only 30 minutes away, consider renting the Car2Go-Smart or Drive Now-Mini right in front of you on the street in order to get home or to the Driving to the hotel pays around 3 € for the 10 minute drive. Members of the services from other cities can also use Cologne's Car-Sharing offers.
Hohenzollern Bridge

The Hohenzollern Bridge is a railway bridge over the Rhine from the main train station to Deutz train station. Built between 1907 and 1911, it was equipped with 4 tracks and a road bridge with tram tracks. In 1945 it was destroyed and rebuilt in 1952, initially with 2 tracks. In 1959 and 1987 it was expanded by 2 tracks each. Only the bridgeheads with the equestrian statues are left of the southern part of the bridge for road traffic. Today's bridge has a pedestrian and bike path. On the southern side, the bars hang fully with Love locks. Often there are padlocks with names that are hung on the bars as a sign of solidarity, and the key is then thrown into the Rhine. On the Deutz side, the Rheinpark with the Tanzbrunnen begins north of the bridge.
On the Deutz side, the German Alpine Club since 1998 a climbing facility with an area of around 850 square meters. [1]
See also article Cologne / city center; the bridges that do not belong to the city center district are also listed here.
Tourist Attractions
.jpg/220px-Kölner_Dom_Südfassade_2011_(2600-02).jpg)

Churches
1 Cologne cathedral. Here at Wikivoyage there is more about the cathedral and about climbing the tower.![]()
2 Cathedral treasury. In the historical cellar vaults from the 13th century on the north side of the cathedral you can see valuable reliquaries, liturgical implements and vestments as well as insignia of the archbishops and cathedral clergy from the 4th to the 20th century, medieval sculptures and Franconian grave finds.Open: Daily from 10 a.m. to 6 p.m. Public tours: Thursdays at 3 p.m.Price: Admission: € 6, reduced: € 3, families: € 12.
One has a particularly beautiful view of the cathedral and Cologne's old town (especially in the evening hours) from the other side of the Rhine in Cologne-Deutz (e.g. from the Rhine boulevard or the freely accessible platform on the eastern bridgehead of the Hohenzollern Bridge).

Romanesque churches
Buildings
Old Town Hall and Praetorium
3 Old Town Hall. A typical Renaissance building is the so-called "arbor", built between 1569 and 1573. The Hansasaal, built around 1330, the 61 m high late Gothic tower built from 1407-14, and the Löwenhof from 1540/41 are still preserved. The parts that were destroyed in the Second World War were partially rebuilt and expanded with modern tracts.
4 Praetorium, under the "Spanish Building" which was rebuilt after the Second World War. The remains of the Roman governor's palace from the 1st to 4th centuries are under the Spanish building. A visit is only possible again when the MiQua Museum, which is currently under construction, has been completed.
The archaeological zone, 10,000 m² excavation area, on which a large Jewish museum is being built, has arisen around and on the town hall square. One of the most important Jewish city quarters in Europe stood here.
In front of the town hall is the ritual Jewish immersion bath (mikveh) from the 12th century with the 20 m deep shaft in which the immersion baths were made with "living water" of the groundwater flow of the Rhine. · Currently closed due to the new MiQua museum.

Gürzenich
5 Gürzenich, Martinstrasse 29-37. The Gothic festival and dance house near the Heumarkt was built by the citizens between 1441 and 1447. In the Middle Ages, emperors and kings were received here. Until the 19th century it was mainly used as a department store. Balls, concerts and carnival events are held in the hall, which was restored in 1952-55.
The adjacent church ruin Old St. Alban is a memorial and memorial for the dead of the two world wars with the stone figure The grieving parents of Käthe Kollwitz. The church, which was destroyed in World War II, was not rebuilt, only the walls were secured. You can look inside through the iron doors. From the stairwell of the Gürzenich and from the Wallraf-Richartz-Museum you can also look directly into the open space of the church.
Patrician house

6 Overstolzenhaus, Rheingasse 8. Romanesque patrician house from the 13th century with a monumental facade and stepped gable. Inside it is decorated with Gothic wall paintings. For a long time it was the seat of the Cologne Stock Exchange. Today the house is used by the art college for media.
The Veedel (district)
The Cologne resident does not live in one of the 86 "official" districts of Cologne, but is connected to his Veedel. The old town north consists of the old town (Martinsviertel), Friesenviertel, Eigelstein and Kunibertsviertel.
For people from Cologne and also for tourists, the Martinsviertel around the church Groß St. Martin between Heumarkt, Alter Markt and today's Rhine is the old town, even if the entire area within the rings is officially listed as Altstadt-Nord and Altstadt-Süd. Outside the rings, the districts of Neustadt-Nord and Neustadt-Süd join, while Deutz is on the Schäl Sick, the wrong side of the Rhine.
Martinsviertel (old town)
The Rheinviertel around St. Martin was an island until the 10th century. Only when a dead arm of the Rhine was filled in was a direct connection to the old town with the old market and the Heumarkt.
Until the twenties of the 20th century, this core district of the city became increasingly impoverished. The building structure and the hygienic conditions of the small and narrow houses deteriorated dramatically. During the term of office of Lord Mayor Konrad Adenauer's, plans for renovation arose, which the National Socialists did not carry out until 1935. By gutting and merging neighboring houses, through numerous new buildings based on historical models and at the same time maintaining the historical streets, an "exemplary" old town was built, which should be reminiscent of a typical "German" Middle Ages. The houses, which were badly damaged in the war, were largely rebuilt after the war according to the ideas of the 1930s. This enabled the Martinsviertel and the Rhine panorama to retain its typically medieval appearance.
During the day there is a lot of international hustle and bustle in the Martinsviertel between the pretty colorful houses with the narrow gables and high roofs. During the day you only hear a few Cologne tones. The old town is by no means a district, some claim, more of a tourist magnet than a place to live. But in the evening, when the tourist buses have left again, the people of Cologne become visible again and the "jote Fründe zesamme" is back.
City and Friesenviertel
The city's shopping streets are to the west of the Gürzenich and the town hall. Further west to the ring is the lively Friesenviertel with many smaller shops.
Eigelstein
The Eigelstein road was part of the Roman military road that led to Xanten. As part of the northern city wall, the mighty Eigelsteintorburg was built in the Middle Ages (1228 - 1260). The “Kölsche Boor” has been watching over a hundred years in a niche in the castle. In the pedestrian zone of the "Eijelsteinsveedel" (Eigelsteinviertel), cafés and restaurants attract visitors to linger in the open-air season around the Torburg and in the direction of Ebertplatz. North of Ebertplatz, the street continues with Neusser Str. There are also some attractive restaurants there.
Südstadt and Severinsviertel
The southern part of the city extends from the Severinsviertel to the southern Neustadt, the demarcation to the Severinsviertel is fluid. Therefore, the two Veedel names have meanwhile become synonymous terms for the entire quarter between the access road to Severinsbrücke in the north and the railway line in the south. The southern city is named after a saint, Bishop Severin, whose Church of the Holy Sepulcher is located on Severinstrasse. In Kölsch it is called “Vringsveedel”. The Severinsviertel has mutated from the former left-wing biotope Südstadt around Chlodwigplatz into a rather apolitical, but still popular place to go out and live. Severinstrasse itself, the business center of the district, follows a Danish / Dutch traffic concept, in which the boundaries between the sidewalks and the carriageway are no longer necessary. The cars (and bicycles) are only allowed to drive a maximum of 20 km / h. At the northern end of Severinstrasse in the direction of the city center, one passes a large construction site at Waidmarkt, the excavation pit for the collapsed historical archive of the city of Cologne.
Rheinauhafen

The architecturally interesting new district at the former Rheinauhafen is located south of the city center. Here are among others. the Chocolate Museum as well as that Sports and Olympic Museum. Not to everyone's taste, but the particularly wide ones are impressive "Crane houses". The rest of the development consists partly of new buildings and partly of converted warehouses. The waterfront was redesigned up to the southern railway bridge. Opposite the Chocolate Museum is the small one Mustard Museum, actually it's just a shop with a historic mustard mill, to which you have free access and where you can find detailed and competent information about this spice. There are also guided tours for a fee (€ 3) every hour. The products offered are of high quality and can be tasted.
7 Bayenturm, southern city fortifications in the Middle Ages facing the Rhine. Since 1990 the tower has housed an extensive library on women's history, art exhibitions, etc. The Association Women's Museum - Art, Culture, Research e.V is the carrier. Please login.Open: Mon - Fri 10 a.m. - 5 p.m.
8 Port Authority north of the Bayenturm
Rings
About 20 m into town from the semicircular ring roads from Theodor-Heuss-Ring to Ubierring was the city wall with 12 gates that enclosed the medieval city (old town). From 1881 it was demolished and a representative Ringstrasse was created for strolling based on the Viennese and Parisian models, mostly used by the Cologne residents as the Rings designated. The houses on the Ring were decorated in a lordly manner; outside the old wall ring, middle-class residential areas were built in the Neustadt towards the end of the 19th century.
The western section between Kaiser-Wilhelm-Ring and Barbarossaplatz in particular is a business and entertainment mile. The area around Chlodwigplatz also has a high density of bars, while the other parts of the rings are mostly offices and residential buildings. Three of the old gate castles of the city wall have been preserved: the Severinstor is on Chlodwigplatz, the medieval Hahnentorburg on Rudolfplatz and the Eigelsteintor on Ebertplatz.
Green belt
The Neustadt is bounded to the outside by the inner green belt. After the old city wall was torn down, this area was initially kept free as a fortress belt. After the First World War, a green area was created on it, which surrounds the city center in a semicircle. The inner green belt is to a large extent separated from the Neustadt by the railway, the border to the outer parts of the city is formed by the four- to six-lane inner canal road bordering the green belt.
Belgian quarter
West of the Hohenzollernring to the inner green belt is the upscale residential area with pretty Art Nouveau facades, galleries and pubs.
Kwartier Lateng
Lively student district around Zülpicher Straße. It's busier on weekends than most other parts of the city.
Klettenberg
Dieser um 1900 auf dem Reißbrett entstandene Stadtteil besteht im Wesentlichen aus vierstöckigen Häusern, gebaut um 1904. Der Stadtteil war praktisch im 2. Weltkrieg unzerstört, die Bausubstanz ist gut erhalten. Einige Häuser im Stil der Bauhausarchitektur sind nach Erweiterung des Viertels später entstanden. Der Bedarf für den Stadtteil entstand durch die stetig wachsende Zahl von Beamten, die im Zentrum keine Wohnungen mehr fanden. Beim Bau von Klettenberg wurde diesen Menschen versprochen, eine Straßenbahnanbindung zu bekommen, die sie trockenen Fußes aus der Innenstadt in ihr Wohngebiet transportiert. Diese Linie existiert als überirdische U-Bahnlinie 18 heute noch, fährt entlang der Luxemburger Straße bis zum Klettenbergpark mit seinem kleinen See, wo der Stadtteil endet. Die Straßen verlaufen in etwa parallel, nur die Siebengebirgsallee quert das Viertel - eine Hommage an den Broadway in New York City. Unter der Luxemburger Straße verläuft der einzige natürliche Bach im linksrheinischen Köln, von dem jedoch nichts mehr zu sehen ist: der w:Duffesbach.
Im Zentrum Klettenbergs befindet sich die Bäckerei Merscher (Nonnenstromstraße Ecke Siebengebirgsallee), die für ihre Sauerteig-Roggenbrote bekannt ist. Die ehemalige Szenekneipe Petersberger Hof (Ecke Petersbergstraße und Siebengebirgsallee) wird heute vorwiegend von Nicht-Kölnern besucht, gehört im Karneval jedoch zu den wichtigsten Kneipen der Stadt. Zu den besten Metzgern zählt, am östlichen Rand von Klettenberg, dem Gottesweg, die Firma Odenkirchen mit teilweise Öko-zertifizierten Produkten.
Klettenberg lässt sich innerhalb von einer halben Stunde erwandern. Interessant ist der nordwestlich angrenzende Beethovenpark (von Konrad Adenauer initiiert) und nördlich das Studentenviertel Sülz. In Sülz befinden sich wesentlich mehr Geschäfte als im ruhigen Wohnviertel Klettenberg. Please refer Köln Klettenberg.
Sülz
Sülz gilt als das Viertel der etwas besser situierten jungen Familien in der Stadt. Es grenzt an die Universität an und wird südlich von der Luxemburger Straße von Klettenberg abgegrenzt.
Deutz

Der rechts des Rheins gelegene zentrale Stadtteil mit dem ehemaligen römischen Kastell Divitia wird auch als Schäl Sick (falsche Seite) bezeichnet. Hier liegt die Kölner Messe und der weitläufige Rheinpark nördlich der Hohenzollernbrücke. Man hat vom Rheinufer einen wunderbaren Blick auf die Kölner Altstadt.Zwischen Hohenzollenbrücke und Deutzer Brücke wurde das Ufer neu gestaltet. Der Rheinboulevard wurde als 516 m breite Freitreppenanlage mit Stufen zum Sitzen und zum Gehen bis Ende 2015 umgebaut.
9 KölnTriangle. Man hat einen fantastischen Rundblick von der Panoramaplattform des LVR Turms auf die Innenstadt. Die nächste Haltestelle ist 'Köln-Messe/Deutz' mit der Deutschen Bahn bzw. 'Bf Deutz/Messe' mit der KVB. Schöner ist es jedoch vom Hauptbahnhof aus zu Fuß über die Hohenzollernbrücke den Rhein zu überqueren, man braucht weniger als zehn Minuten. Der Turm ist nicht zu übersehen (neben dem Hyatt). Die Auffahrt zur Plattform erfolgt mit einem schnellen Aufzug. Oben legt man die letzten Höhenmeter bis zum Dach über Treppen back. Der Bau des KölnTriangle 2004 bis 2006 war nicht unumstritten, das Hochhaus sollte nur das erste von einer Reihe von Hochhäusern auf der rechten Rheinseite sein. Aus diesem Grund war der Kölner Dom von 2004 bis 2006 auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes. Nachdem die Hochhausplanung der Stadt Köln 2006 verworfen worden war, wurde der Dom von der Roten Liste des gefährdeten Welterbes gestrichen.Geöffnet: Aussichtsplattform: 1.Mai – 30. September: Mo – Fr :11–23 Uhr; Sa., So. und Feiertage 10–23 Uhr; 1. Oktober – 30. April: Mo – Fr: 12 – 20 Uhr; Sa., So. und Feiertage 10–20 Uhr. Bei Gewitter und Sturm aus Sicherheitsgründen geschlossen.Preis: Auffahrt: 3 €, Kinder bis 12 J.: frei.

City walls and gateways
Roman times
Um 50 bis 70 n. Chr. entstand eine 4 km lange und 7,7 m hohe Stadtmauer mit 9 Toren und 22 Türmen. Von ihr sind einige wenige Zeugnisse noch heute erhalten, z.B. ein Teil des Nordtors beim Dom, der Römerturm, der Helenenturm und das Ubiermonument (Hafenturm).
middle Ages
1180 wurde die 7,5 km lange mittelalterliche Stadtmauer mit 12 Toren und 52 Wehrtürmen halbkreisförmig errichtet. Die Stadtmauer verlief entlang der heutigen Ringe. Nach dem Schleifen der Mauer wurde auf der Außenseite ein langer Pracht-Boulevard mit repräsentativen Häusern um die Altstadt gelegt. Von den 12 Toren sind noch folgende erhalten:

- 10 Eigelsteintorburg in the North,
- 11 Hahnentorburg am Rudolfplatz im Westen
- Stadtmauer am Sachsenring
- 12 Ulrepforte am Sachsenring
- 13 Severinstorburg im Süden auf dem Clodwigplatz im Severinsviertel
Auch am Hansaring ist ein Mauerabschnitt erhalten, jedoch ohne Tor. Am Rheinufer befindet sich als weiterer Rest der Stadtbefestigung der Bayenturm, ursprünglich der südöstliche Endpunkt der Stadtmauer. Ein kleiner Turm ist am Konrad-Adenauer-Ufer erhalten.
Museums
- 14 Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln. Tel.: 49 (0)221 22 12 44 38, Fax: 49 (0)221 22 12 45 90, Email: [email protected]. Seit Januar 2019 für einige Jahre auf Grund umfangreicher Sanierung closed. Ersatzweise gibt es einen Teil der Ausstellung nun im Belgischen Haus (Cäcilienstraße 46) zu sehen. Archäologischen Exponate aus der Kölner Geschichte. Römisches Mosaik aus der Zeit 220 n. Chr. Es kann abends von Außen durch die Fenster betracht werden. Es zeigt Szenen aus der Welt des Dionysos.Geöffnet: Mittwoch bis Montag 10 - 18 Uhr.Preis: 6€, ermäßigt 3€, Schüler frei.
- Archäologische Zone und Jüdisches Museum unter und auf dem Rathausplatz − An den Originalstandorten treffen die Besucher auf Monumente aus zwei Jahrtausenden. Von den gewaltigen Ruinen des römischen Statthalterpalastes bis zu den fragilen Resten eines der bedeutendsten jüdischen Stadtquartiere Europas wird in dem Ausgrabungsprojekt Kölner Stadtgeschichte präsentiert.
- 15 Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz. Umfangreiche Sammlung zur Kunst des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart (bedeutende Werke des Expressionismus und der Pop Art; eine der bedeutendsten Picasso-Sammlungen; außerdem russische Avantgarde und Expressionismus; Gegenwartskunst). Regelmäßige Wechselausstellungen.Preis: Eintritt: 12,- €, ermäßigt 8 €, Familien 24,- €, Kinder unter 18 Jahre: frei in die ständige Sammlung, Gruppen 9,- € pro Pers.
- 16 Wallraf-Richartz-Museum, Obenmarspforten. Tel.: 49 (0)221 221 211 19. Werke vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert.Geöffnet: Di - So sowie an bestimmten Feiertagen: 10 - 18 Uhr; 1. und 3. Donnerstag im Monat bis 22 Uhr.Preis: 9 €, ermäßigt 5,50€.
- 17 Museum für Angewandte Kunst − MAKK, An der Rechtschule, beim Wallrafplatz. Tel.: 49 (0)221 - 221 267 14 (Kasse), 49 (0)221 - 221 238 60 (Sekretariat), Fax: 49 221 221 238 85, Email: [email protected]. Sammlungen: Möbel und Raumkunst, Schmuck, Design, Keramik, Textil und Mode, Gemälde und Skulptur, Porzellan, Bildende Kunst des 20. Jahrhunderts, Glas, Metallkunst, Grafik und Plakat, Buchkunst. Die international renommierte Design-Sammlung gehört zu den qualitätvollsten und größten Kollektionen ihrer Art in Europa.Geöffnet: Di. - So. 10-18 Uhr.Preis: Eintritt Ständige Sammlungen: 6,- €, erm,: 3,50, Kombiticket: 8 - 12 €, erm.: 3 - 9 €.
- 18 Museum für Ostasiatische Kunst, Universitätsstraße 100. Tel.: 49(0)221-221-28608, Email: [email protected]. − Große Sammlung von Kunstwerken aus China, Japan und Korea.Geöffnet: Di − So von 11 - 17 Uhr, 1. Donnerstag im Monat von 11 - 22 Uhr.Preis: Eintritt Sammlung: 6,- €, ermäßigt: 3,50 €, während Sonderausstellungen: 9,50 €, ermäßigt 5,50 €.
- 19 Rautenstrauch-Joest-Museum, Cäcilienstr. 29-33. Tel.: 49(0)221 221 - 313 56. Das Rautenstrauch-Joest-Museum ist das einzige ethnologische Museum in Nordrhein-Westfalen und besitzt eine der zehn größten ethnologischen Sammlungen in Deutschland.Geöffnet: Di bis So 10–18 Uhr, Do 10–20 Uhr, jeden 1. Do. bis 22 Uhr.Preis: Eintritt Dauerausstellung: 7,- €, ermäßigt: 4,50 €, nur Sonderausstellung: 4 €, ermäßigt: 3 €, Kombiticket mit Museum Schnütgen: 10 € , ermäßigt: 7 €. Audioguide: 2,- €.
- 20 Museum Schnütgen, Cäcilienstr. 29-33. Tel.: 49(0)221 221-22 310. überwiegend kirchliche und auch profane Schätze (ca. 8.–15. Jh.) in der ehemaligen Romanische Kirche St. Cäcilien. Zugang über den Neubau. Nicht überall barrierefrei.Geöffnet: Mo: geschlossen, Di-So: 10-18 Uhr, Do: 10-20 Uhr, jeden 1. Do. bis 22 Uhr.Preis: Eintritt: 6,- €, ermäßigt: 3,50 €.
- 21 Imhoff-Schokoladenmuseum, Im Rheinauhafen. Tel.: 49(0)221 931 888-0. Im Museum wird die Geschichte der Kakaobohne gezeigt und es gibt dort auch die industrielle Herstellung von Schokoladenprodukten zu sehen, die man direkt auch im Museumsshop erwerben kann.Geöffnet: 10–18 Uhr, Montags in Nov, Jan bis März geschlossen.Preis: Eintritt: 12,50 €, ermäßigt: 9 €, Schüler / Kinder: 7,50 €, Familienkarte: 30,– €.
- 22 Deutsches Sport und Olympiamuseum, Im Zollhafen, Nähe Schokoladenmuseum. Tel.: 49(0)221 33 609 0, Email: [email protected]. Trendsportarten,Geöffnet: Di - So: 10 - 18 Uhr.Preis: Eintritt 6 €, ermäßigt 3 €, Familienkarte 15€.
- 23 NS-Dokumentationszentrum, Appellhofplatz 23–25. Tel.: 49(0)221 2212 6332. Das Haus, das früher als Zentrale der Kölner Gestapo gedient hat, bietet im Rahmen der ausführlichen Ausstellung Medienstationen, Info-Tafeln und Ausstellungsstücke. Im Keller befindet sich das ehemalige Gestapogefängnis, komplett mit den verzweifelten Inschriften der Gefangenen. Das Gebäude ist auch unter dem Namen "ELDE-Haus" bekannt, lautsprachlich abgeleitet nach den Initialen des Erbauers Leopold D.ahmen.Geöffnet: Di-Fr 10-18, Sa, So 11-18 Uhr, 1. Do. im Monat (außer an Feiertagen) 10-22 Uhr.Preis: Erwachsene 4,50 EUR, ermäßigt 2,00 EUR, freier Eintritt für Schüler und Kinder / Jugendliche unter 18 Jahren.
- 24 Odysseum. Das Odysseum Abenteuermuseum bietet ein abwechslungsreiches Angebot an Stationen, die kleine und junge Forscher in ihren Bann ziehen. Temporäre Wechselausstellungen runden das Gesamtbild ab. Außerdem befindet sich dort das "Museum mit der Maus".Preis: Eintritt: 16,- €, ermäßigt 12.- €, Familien 44,- €,.
Theaters and concert halls
- Das Große Schauspielhaus mit Oper und Theater wird seit Juni 2012 saniert und ist voraussichtlich noch bis 2024 closed. Die Ersatzspielstätten sind das Depot 1 und 2 auf dem ehemaligen Carlswerk in Köln-Mülheim und das Staatenhaus im ehemaligen Messegelände in Deutz..
- Köln hat über 30 private Spielstätten der Theater-Szene Köln, wie z.B. die Kleinkunstbühne Senftöpfchen-Theater.
- Der Gürzenich wird nur noch selten als Konzerthaus genutzt. In der Karnevalszeit finden dort zahlreiche Sitzungen statt, sonst oft Kongresse oder Empfänge. Das städtische Philharmonieorchester heißt zwar traditionell noch Gürzenich-Orchester, spielt aber meistens in der Philharmonie.
- Auch im Funkhaus des WDR gibt es im Großen und Kleinen Sendesaal (Eingang Wallrafplatz) manchmal Konzerte.
Philharmonic
Zwischen den Untergeschossen des Museum Ludwig und der Tiefgarage sowie zwischen Dom und Rhein gelegen befindet sich im Keller die Philharmonic mit 2000 Besucherplätzen.
Cologne Opera
The Cologne Opera wird seit Juni 2012 und noch bis mindestens Herbst 2024 saniert. Die neue Hauptspielstätte war von 2012 bis 2015 die »Oper am Dom«, dem Musicaldome. Seit 2015 ist das Staatenhaus am Rheinpark in Deutz Ersatzspielstätte.
Musical dome
The 1 Musical dome ist eine ursprünglich provisorisch errichtete Spielstätte für Musicals neben dem Hauptbahnhof direkt am Rhein. Von 2012 bis 2015 diente er auch als Ersatzspielstätte der Oper Köln. Das runde blaue Polyesterdach ist besonders des Nachts von der Deutzer Rheinseite ein leuchtender Punkt am Rheinufer.
Parks, gardens and recreational areas
Einer der größten Parks in Köln, der 25 Rheinpark liegt rechtsrheinisch nördlich direkt im Anschluss der Messe. Dieser Park ist auch über eine Seilbahn über den Rhein erreichbar, die von Zoo und Flora aus startet. Sehr sehenswert ist auch die Flora, der Botanische Garten von Köln.
Banks of the Rhine
The Altstadt-Rheinufer (linksrheinisch), auch als Rheingarten bezeichnet, ist seit der Untertunnelung der Rheinuferstraße eine beliebte Flaniermeile. Die Verlängerung über den Rheinauhafen bis zur Südbrücke wurde 2010 fertiggestellt. Auch nach Norden besteht ein schöner Fuß- und Radweg direkt am Rheinufer.
The Deutzer Ufer (rechtsrheinisch) zwischen der Eisenbahnbrücke und der Deutzer Brücke wurde von 2013 bis 2015 zu einem treppenartigen Promenadenufer umgebaut. Dabei wurden auch Reste des ehemaligen Römerkastells Divitia ausgegraben.
Rheinpark

- Parkanlage − das ehemalige Bundesgartenschaugelände nördlich der Deutzer Brücke zwischen Rhein und Messe wird von den Kölnern gerne zur Naherholung genutzt. Man findet hier weitläufige Wiesenflächen zum Picknicken sowie einen großen Kinderspielplatz. Auch eine kleine Parkeisenbahn verkehrt in der Anlage, Fahrpreis für den Rundkurs: 3,50 €. Im April stehen die Bäume in voller Blütenpracht.
- The Tanzbrunnen – ist ein Kultur- und Freizeitpark mit Open-Air-Bühne zwischen Messe und Rheinpark. Auf dem weitläufigen Areal locken in der Sommersaison verschiedene Märkte wie der Fischmarkt oder Blumen- und Gartenmarkt. • Veranstaltungskalender
- Rheinterrassen − Ausflugsrestaurant über dem Zugang zum Rheinpark.
- Rheinboulevard − Rheinpromenade zwischen Rheinpark und Pollerwiesen. Sie wurde von Herbst 2013 bis Sommer 2015 neu gestaltet und erhielt eine große Wassertreppe zwischen Hohenzollern- und Deutzer Brücke.
- Rhine cable car: Deutschlands älteste Seilbahn, die über einen Fluss führt, wurde in den 1950er Jahren erbaut. Sie verbindet Zoo und Flora mit dem rechtsrheinischen Rheinpark. Seit 1966 quert sie die Zoobrücke, die hier ebenfalls den Rhein überquert. Fahrbetrieb von Ende März bis Anfang Nov., täglich von 10 − 17:45 Uhr. Fahrpreis: 4,50 €, hin u. zurück: 6,50, Kinder: 2,50 € / 3,70 €.
flora


- 26 Botanischer Garten Köln, neben dem Zoo (Anfahrt: Stadtbahn „Zoo/Flora“). Ein Spaziergang ist unbedingt empfehlenswert. Heute werden hier 10.000 Pflanzenarten aus allen Vegetationszonen im Freiland und Gewächshäusern kultiviert. Zwischen 2011 und 2014 wurde das Veranstaltungsshaus der Flora (ebenfalls Flora genannt) generalsaniert. Das Haus hat wieder das ursprüngliche Kuppeldach erhalten und wurde im Juni 2014 wiedereröffnet. Die Gewächshäuser (Ausnahme: Subtropenhaus) werden von 2018 bis 2022 saniert und können deshalb zur Zeit nicht besucht werden.Geöffnet: Garten: 8 Uhr bis zum Eintritt der Dunkelheit, Gewächshäuser: von Oktober bis März 10–16 Uhr, von April bis September 10–18 Uhr. Vom 24. Jan. bis zum 21. April 2014 läuft die jährliche Kamelienausstellung im und um das Subtropenhaus.Preis: Der Eintritt in die Flora ist frei.
More parks and gardens

- Im Süden und Westen der Stadt zwischen Militärringstraße und Autobahn A4 liegt der lange Äußere Grüngürtel der zu ausgedehnten Spaziergängen oder auch Waldläufen einlädt. Nördlich des Stadtteils Bocklemünd gibt es eine Fortsetzung bis zur Neusser Landstraße, die aber leider durch eine Autobahn, eine Eisenbahnstrecke und eine Kaserne unterbrochen wird. Abgesehen von den ausgedehnten Grünflächen ist der Äußere Grüngürtel auch attraktiv wegen des im Südwesten gelegenen Decksteiner Weihers mit dem Café-Restaurant „Haus am See” an seinen Ufern.
- The Innere Grüngürtel befindet sich am Rand der Neustadt und führt mit einigen Unterbrechungen halbkreisförmig um die Innenstadt, parallel zur Inneren Kanalstraße, bzw. Universitätsstraße. Er besteht im Wesentlichen aus zwei Abschnitten. Der nördliche Abschnitt beginnt am Rheinufer neben der Zoobrücke mit dem Skulpturengarten und führt bis zu den Eisenbahnbrücken an der Escher Straße. Der südliche Abschnitt beginnt hinter den Gleisanlagen am Herkulesberg - einem Berg aus dem Trümmerschutt des 2. Weltkriegs - und führt dann am Aachener Weiher und dem Universitätshauptgebäude vorbei bis zur Luxemburger Straße. Eine weitere Verlängerung Richtung Rheinufer ist in Planung.
- Südlich der Autobahn A4 in Rodenkirchen liegen der kostenlose "Forstbotanische Garten" mit seinen fremdländischen Bäumen, der "Friedenswald" and the Finkens Garten, Linien 16 und 17, (H) Rodenkirchen.
- The Stadtwald in Lindenthal zwischen Aachener Straße und Dürener Straße beheimatet einen kleinen Tierpark. (Linie 1, (H) Clarenbachstift, Linien 7, 13, 136, (H) Dürener Straße/Gürtel, Linien 7 und 136, (H) Brahmsstraße) Über eine Fußgängerbrücke geht der Stadtwald über in den Äußeren Grüngürtel. Dort gibt es auch einen kleinen See, den Adenauerweiher.
- Japanischer Garten an der Stadtgrenze zu Leverkusen
- Der älteste Kölner Park ist der City garden an der Venloer Straße (U-Bahnhof Hans-Böckler-Platz, Linie 3,4,5). Er ist zwar nicht sehr groß, aber mit vielen alten Bäumen und einer Kneipe mit Biergarten ausgestattet. In dieser Kneipe finden zahlreiche Konzerte statt, musikalischer Schwerpunkt ist Jazz in allen Varianten. Über eine Brücke kann man vom Stadtgarten in den erst vor wenigen Jahren angepflanzten Mediapark gehen, eine weitere Brücke führt von dort in den Inneren Grüngürtel (s.o.).
- Am meisten los ist im Volksgarten, einem mittelgroßen Park in der Südstadt (Linie 12, Haltestelle Eifelplatz). Hier trifft sich bei schönem Wetter alles vom Kleinkind bis zum Rentner, einen Tretbootverleih auf dem kleinen Weiher und einen Biergarten gibt es auch.
- Nicht unbedingt zu den Parks gehörig, aber trotzdem für ruhige Spaziergänge unter alten Bäumen geeignet, sind die großen Kölner graveyards. Vor allem der Melatenfriedhof, der Nord- und Südfriedhof bieten sich an. Auf dem Melatenfriedhof kann man auch viele alte Grabdenkmäler bewundern, viele prominente Kölner sind dort und auf dem Südfriedhof bestattet.
- Im rechtsrheinischen Köln gibt es außer dem Rheinpark nicht viele Parkanlagen. Jedoch kann man fast das gesamte rechte Kölner Rheinufer entlangwandern (Fahrrad geht auch) und trifft dabei immer wieder auf kleinere Grünflächen.
- Dafür gibt es etwas weiter außerhalb im rechtsrheinischen einige ausgedehntere Waldgebiete. Am bekanntesten ist der Königsforst (Stadtbahn Linie 9 bis Endstation Königsforst). Hier kann man stundenlang durch den Wald gehen. Damit man sich nicht verläuft, sind viele Wanderwege unterschiedlicher Länge markiert. Südlich anschließend ist die Wahner Heide, die z.T. Naturschutzgebiet ist. Diese reicht bis zur Nachbarstadt Troisdorf. (Linie 9 bis (H) Königsforst, dann Linie 423 bis (H) Gut Leidenhausen, Linie 161 bis (H) Grengel Mauspfad oder S12 / S19 bis (H) Troisdorf, dann Linie 506 bis (H) Wahner Heide / Fliegenberg, Jägerhof oder Altenrath.) Leider kann es in beiden Gebieten laut werden, da der Flughafen direkt nebenan liegt. Auch im Nordosten der Stadt, zwischen dem Kölner Stadtteil Dünnwald, dem Bergisch-Gladbacher Stadtteil Schildgen und dem Leverkusener Stadtteil Schlebusch gibt es ein größeres Waldgebiet, das aber touristisch nicht so erschlossen ist wie der Königsforst (Stadtbahn Linie 4 bis Odenthaler Straße oder S-Bahn S 11 bis Köln-Dellbrück).
zoo
27 Kölner Zoo (Linie 18, Haltestelle: Zoo/ Flora), Riehler Straße 173. Tel.: 49 (0)221 567 99 100, Email: [email protected]. 1860 gegründet, drittältester zoologische Garten in Deutschland. Er wurde noch 2004 zum schönsten Zoo Deutschlands gekürt.
- Besonders erwähnenswert: − Das URWALDHAUS für Menschenaffen (1985)(das Einzige seiner Art in Deutschland) - Zwei Anlagen für Großkatzen("Der REGENWALD") − Ein den Urwäldern Südostasiens gewidmetes TROPEN und VOGELHAUS - ELEFANTEN Park (größter seiner Art in Europa)- HIPPODROM (Flusspferde, Nilkrokodile, Antilopen).
- Mit dem Clemenshof befindet sich auch eine Abteilung für seltene Haustierrassen im Kölner Zoo
- Besondere Veranstaltungen des Kölners Zoos : Lange Zoo-Nacht-Zelten im Zoo- Nachtführungen im Sommer
various
- Colonius – Der Kölner Fernmeldeturm im Westen der Stadt ist seit 1992 nicht mehr für Besucher zugänglich. Es findet sich kein Pächter für das Drehrestaurant im Turm. Der 1981 eröffnete Turm ist mit 266 m das höchste Bauwerk der Stadt.
- Köln ist darüber hinaus auch Standort für zahlreiche Kunst-Galerien, wie z.B. Galerie Karsten Greve, Galerie Thomas Zander.
activities
City tours
Finger weg von den teuren, geführten Stadt-Touren! Alles was man zu sehen bekommt, kann zumeist auch kostenlos besucht werden (wenn man irgendwie Eintritt zahlen muss, muss man den bei einer geführten Tour zusätzlich auch bezahlen!). Man passe auf, dass man nicht 20 Euro dafür bezahle, jemand eine Stunde auf der Domplatte mit Fakten über den Dom zuplaudert, die man im Inneren auch selber nachlesen kann! Bei den Stadtführern muss man sehr auf Aktualität achten. Man sollte die Touristeninformation direkt am Fuße der Domplatte besuchen. Dort gibt es einige kostenlose, neue und interessante Stadtführer. Haltestelle: Dom/ Hauptbahnhof.
Segway Tour Köln (Seg Tour GmbH), An Groß St. Martin 6. Tel: 49 221 27260597, Email: [email protected]. Stadtführung auf verschiedenen Routen durch Köln mit dem elektrischen Stehroller "Segway®". Neben der Classic Tour zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten steht auch eine historische zur Auswahl. Auch buchbar für Events, Firmenausflüge oder Jungesellenabschiede. Preis: 75,00 EUR. Akzeptierte Zahlungsarten: Bar, Master, Visa, Amex, Apple Pay, Google Pay, EC.
Cherrytours Köln - Meine Stadtführung (Cherrytours GmbH), An Groß St. Martin 6. Tel.: 49 221 27747031 , Email: [email protected]. Stadtführungen privat oder in kleinen Gruppen für Individualisten, für interessierte die nicht nur zur Domplatte Informationen wünschen. Täglich Touren verfügbar, auch in verschiedenen Sprachen. Individuelle Start- und Endpunkte auf Anfrage möglich. Preis: ab 15 EUR. Akzeptierte Zahlungsarten: Bar, Master, Visa
Eine neue Alternative für lesefaule Individualisten: Einen akustischen Stadtführer durch Köln kann man auf den eigenen mp3-Player oder iPod herunterladen und losmarschieren. Ein anderer Audio-City Guide im MP3-Format zum Herunterladen ist der sogenannte "Stadtführer zum Hören", den es auch in englischer Sprache gibt.
Kölsch feeling
Für das Kölsche Feeling sorgen die urigen und gemütlichen Kneipen rund um den Alter Markt und Heumarkt oder die großen Brauhäuser in der ganzen Altstadt. Dort wird Kölsch, das berühmte Kölner Bier, ausgeschenkt und rheinische, meist deftige Spezialitäten serviert (siehe auch Abschnitte kitchen or. nightlife).
carnival
- Karnevalsauftakt am 11.11 um 11 Uhr 11 auf dem Heumarkt und in der Altstadt;
- Die Veranstaltung auf dem Heumarkt mit den großen Stars der Kölner Karnevalsmusik beginnt ab 10 Uhr und ist meist bereits kurze Zeit später mit bis zu 70.000 Besuchern völlig überfüllt, sodass der ganze Platz von der Polizei abgeriegelt wird. Die Sanitäranlagen (insbesondere für Damen) sind dementsprechend hoffnungslos überlastet. Das offizielle Programm endet am späten Nachmittag, in der Altstadt wird aber weitergefeiert. Das Fernsehen / WDR überträgt live.
- Weiberfastnacht am Donnerstag, 24. Februar 2022 – Auftakt des Kölner Straßenkarnevals mit der Schlüsselübergabe der Stadt an den Prinzen des Dreigestirns. In ganz Köln wird bis tief in die Nachtstunden auf den Straßen, in den Kneipen und Büros gefeiert. Zudem sollten sich an diesem Tag Krawattenträger vor Frauen mit Scheren in Acht nehmen. Die Geschäfte haben ab Mittag oder ganz geschlossen.
- The Geisterzug in Köln am 26. Februar 2022, ab 19 Uhr
- Schull- und Veedelszöch am Tulpensonntag, den 27. Februar 2022 in der Innenstadt
- Rosenmontagszug am Montag, 28. Februar 2022
- Nubbelverbrennung am Veilchendienstag (1. März 2022) – Vor vielen Kölner Kneipen wird der Nubbel verbrannt. Die Strohpuppe muss als Sündenbock für alle während der Karnevalszeit begangenen Verfehlungen herhalten. In sämtlichen Kölner Veedeln muss der Nubbel büßen.

Cologne Lights
Jährlich findet im Juli die Musik- und Feuerwerksveranstaltung Cologne Lights statt.Die nächsten Termine: 18. Juli 2020 (fällt wegen Corona aus), 10. Juli 2021, 09. Juli 2022, 15. Juli 2023
Christmas markets
- Christmas Market am Kölner Dom auf dem Roncalli Platz, über 100 kostenfreie Bühnenveranstaltungen unter dem Lichterzelt · U-Bahnhof: „Dom/Hbf.“.
- Weihnachtmarkt Kölner Altstadt auf dem Alter Markt und Heumarkt · U-Bahnhöfe: „Rathaus“ und „Heumarkt“.
- Markt der Engel auf dem Neumarkt · U-Bahnhof: „Neumarkt“.
- Vringsadvent auf dem Chlodwigplatz mit der größten Feuerzangenbowle der Welt
- Nikolausdorf − Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz
- Weihnachten am Wasser − Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum
- Christmas Avenue − Schwul-lesbischer Weihnachtsmarkt
- Christmas Market im Stadtgarten, eher etwas kleiner, aber mit relativ gemütlicher Atmosphäre
- Glühwein im Veedel − Christmas markets in den Stadtteilen
Swimming
Wellness
- 2 Claudius Therme (am Rheinpark an der Rheinseilbahn. Der Bus 150 fährt vom Bahnhof Deutz/Messe zur Therme), Sachsenbergstr. 1. Therme, Sauna, Beauty & Wellness, Physiotherapie, Gastronomie.
- The KölnBäder GmbH betreibt 13 Schwimmbäder mit unterschiedlichen Ausstattungen im Kölner Stadtgebiet, mit Eintrittpreisen ab 4 Euro für Erwachsene.
shop
Supermärkte haben häufig Montag bis Samstag von 8 bis 20 oder 22 Uhr geöffnet, in Einzelfällen auch länger.
Eine Kölner Besonderheit – die es vergleichbar in Deutschland eigentlich nur noch im Ruhr area gibt – sind die Kioske ("Büdchen" genannt). Ein solcher Kiosk ist fast überall in Köln innerhalb von wenigen Minuten zu erreichen und bietet neben einer reichhaltigen Auswahl an Getränken meist auch das Wichtigste für den alltäglichen Bedarf (Hygieneartikel, kleine Auswahl an Lebensmitteln). Das Besondere ist, dass die Kioske in der Regel auch noch weit nach 20 Uhr geöffnet haben. In den Ausgeh-Vierteln auch bis tief in die Nacht.
Zum Shoppen kann man sich auf die Schildergasse and Hohe Straße (Haltestellen: Dom/ Hauptbahnhof, Neumarkt, Heumarkt) begeben, falls man nach Filialen der großen Ketten sucht. The Ehrenstraße and Breite Straße (Haltestellen: Neumarkt, Appellhofplatz) bieten eher kleinere Läden und alternative Einkaufsmöglichkeiten.
Auf der rechten Rheinseite bietet sich die Deutzer Freiheit zum Einkaufen an, (H) Deutzer Freiheit (Stadtbahnlinien 1, 7 und 9) oder (H) Bf. Deutz / Messe bzw. (H) Bf. Deutz / LanxessArena (Regionalexpress- und Regionalbahnlinien, alle S-Bahn-Linien, die Stadtbahnlinien 1, 3, 4 und 9 sowie einige Buslinien)
kitchen
Meist bekommt man als Ortsunkundiger den Ratschlag, in die Altstadt zu gehen. In der Tat sind viele Bereiche der Altstadt vom Autoverkehr befreit und es reihen sich zahlreiche traditionelle und internationale Gastwirtschaften bzw. Kneipen und Restaurants aneinander. Hier bekommt man nicht nur internationale Speisen und Getränke, sondern auch die kölschen kulinarischen Spezialitäten und natürlich das "Kölsch".
Vielen Kölnern ist die Altstadt entweder zu teuer oder touristisch zu überlaufen. Man weicht da lieber auf die Ausgehmeilen z.B. entlang der Ringe aus.
- Brauhäuser mit Biergarten und Restaurants findet man im Unterartikel/Innenstadt-->hier listed.
Rhenish specialties

- Himmel un Ääd - gebratene Blutwurst mit Kartoffelbrei und Äpfeln
- Halve Hahn - Dicke Scheibe mittelalter Gouda auf einem Roggenbrötchen Röggelchen mit Zwiebeln und Senf - met Öllich un Mostard
- Kölscher Kaviar - Blutwurst mit Zwiebeln, Flönz ist der Name der Blutwurst
- Rievkooche - eine typisch rheinische Kartoffelspezialität.
- Hämchen met suure Kappes - Eisbein mit Sauerkraut
- A Krüstchen steht eigentlich für eine Brotkante, ist aber auch der Ausdruck für ein Schnitzel auf einer Scheibe Roggenbrot mit einem Spiegelei überbacken. Es kann aber auch eine kleine Portion Gulasch mit Röggelchen als Krüstchen warm or Krüstchen Gulasch gemeint sein.
- Ädäppelszupp - Kartoffelsuppe
- Suurbroode or Soorbrode - Rheinischer Sauerbraten mit Rosinen, Klößen und Apfelkompott.

Restaurants
upscale
- 1 Moissonier (2 Sterne, französischer Bistro-Stil, kleines Sternerestaurant mit ca.50 Plätzen. Man sollte reservieren.w: Menchon: Vom "Feinschmecker" zum "Koch des Jahres" gekürt , Video auf der Restaurantseite), Krefelder Str. 25. Preis: z.B. Menu 78€.
- 2 Himmel un Äd, Kaygasse 2. Tel.: 49(0)221 2008171. 1 Stern, Regionale deutsche gehobene Küche.Geöffnet: Di - Sa 18.30 - 22.00 Uhr.Preis: 15 €. bis 75 €.
- 3 La Poêle d’Or, Komödienstr. 50. Tel.: 49(0)221 13986777. 1 Stern, französische moderne gehobene Küche.Geöffnet: Di - Sa 12.00 - 14.00 und 18.30 - 22.00 Uhr.Preis: 26 € bis 95 €".
- 4 Taku, Trankgasse 1-5 / Domplatz. Tel.: 49(0)221 2703910. 1 Stern, asiatische moderne gehobene Küche.Geöffnet: Di - Sa 12.00 - 14.00 und 18.00 - 21.30 Uhr.Preis: 35 € bis 119 €.
- 5 Alfredo, Tunisstr. 3. Tel.: 49(0)221 2577380. 1 Stern, italienische Küche.Geöffnet: Mo - Fr 12.00 - 15.00 und 18.00 - 23.00 Uhr.Preis: 48 € bis 74 €.
- La Société, Kyffhäuser Str. 53. Tel.: 49(0)221 232464. 1 Stern, moderne französische Küche.Geöffnet: täglich 18.30 - 23.00 Uhr.Preis: 60 € bis 80 €.
- Maitre im Landhaus Kuckuck, Olympiaweg 2. Tel.: 49(0)221 485360. 1 Stern, französische Küche.Geöffnet: Mi - So 19.00 - 22.00 Uhr.Preis: 38 € bis 99 €.
- maiBeck, Am Frankenturm 5. Tel.: 49(0)221 96267300. 1 Stern.Geöffnet: Di - Sa 12:00 - 15:00 und ab 17:30, Sonntags ab 12:00 durchgehend.Preis: Menü: 42€ - Karte: 41€-55€.
- Poisson - In der Nähe des Neumarkts, das derzeit mit 16 von 20 Punkten im Gault Millau bewertet wird.
Wer sich für das Außerordentliche im kulinarischen Bereich interessiert, kann mit der Stadtbahn line 1 Richtung Bensberg zum Schloss Bensberg fahren und sich dort im Restaurant Vendôme auf eine kulinarische Reise begeben. Hier kocht seit 2000 Joachim Wissler, der zu den zehn deutschen Drei-Sterne-Köchen gehört und 2012 von seinen Kollegen zum „Koch der Köche“ gewählt worden ist.
Weitere Visitenkarten für Restaurants findet man in den Unterartikeln in denen die Bezirke beschrieben werden.
nightlife
Gerade am Abend lohnen sich natürlich auch die oben erwähnten Brauhäuser. Wer allerdings zu den besonders Nachtaktiven gehört, sollte sich nicht vornehmen, den Abend auch dort zu beenden, denn die meisten Brauhäuser schließen vergleichsweise früh.

Cheap
Neben der Altstadt (siehe unten) hat wahrscheinlich das Studentenviertel, das so genannte Kwartier Latäng, am Zülpicher Platz und Barbarossaplatz (Haltestellennamen ebenso) die größte Kneipendichte. Der Kern des Viertels ist zwischen Zülpicher Straße und Luxemburger Straße. Allerdings findet man hier weniger die kölschen klassischen Kneipen, sondern Bars, Cafés, Restaurants, Imbissbuden, Clubs und die eine oder andere Überraschung.Am sinnvollsten ist es, am Wochenende das Viertel zu "erkunden". So findet jeder "sein" Lokal.Das Publikum ist bis ca. 30 Jahre vertreten, aber das Alter spielt keine Rolle. Die Preise sind meist studentengerecht. Besonders günstig sind Cocktails, da sehr viele Bars eine Happy Hour haben, bei einigen dauert diese "Stunde" den ganzen Abend, so dass man auch gute Cocktails oftmals für etwa vier Euro bekommt.
The Stadtteil Ehrenfeld entwickelt sich langsam zu einem Szeneviertel. Auch hier gibt es Kneipen, Bars, Restaurants und Clubs. Sie konzentrieren sich in Alt-Ehrenfeld.
Die beliebtesten Partys und Konzerte sind z.B. im Luxor, Rose Club (beide Luxemburger Str.), Live Music Hall (Ehrenfeld), GEBÄUDE 9 (Deutz) oder E-Werk (Mülheim) in guter Preislage. Zügig entwickeln sich auch neue Clubs wie Die Werkstatt (Siberschwein-Party) in Ehrenfeld und das Gewölbe am Westbahnhof.
medium
Ebenfalls ein bisschen teurer ist es oftmals in der Kölner "Südstadt" (Haltestellen: Chlodwigplatz, Ubierring). Die Südstadt mit ihren Bars und Kneipen gilt im Vergleich zu anderen Vierteln noch immer eher als alternativ – auch wenn man das nicht immer merkt.
Breweries and pubs

Man findet eine urige Atmosphäre an gescheuerten Holztischen, wird bedient vom Köbes (Jakob, weibliche Köbesse nennen sich Köbinen), der hoffentlich Humor mitbringt, wenn man sich als Köln Unkundiger outet (eine gewisse stachelige Distanziertheit zum Gast ist Einstellungsvoraussetzung ). Ein leeres Kölschglas wird vom Köbes unaufgefordert durch ein volles Glas ersetzt. Wer nichts mehr trinken möchte , muss den Bierdeckel auf das Glas legen. Hilft dies auch nicht, muss man das Gläschen halbvoll stehen lassen. Diese Lokale werden meistens von Gästen jenseits der Dreißig besucht.
- Ausgewählte Brauhäuser und Kneipen findet man hier mit Adressen und Link zur Openstreetmap und in den anderen Stadteilartikeln.
accommodation
Cheap
Günstige Übernachtungsmöglichkeiten bieten neben dem neu gebauten Jugendgästehaus in Deutz in der Siegesstr. 5 (Haltestelle: Messe/Deutz), der Jugendherberge Köln-Pathpoint in der Allerheiligenstraße 15 nördlich des Hauptbahnhofs und der vergleichsweise abseits gelegenen Jugendherberge Köln-Riehl in der Riehler Aue am Rein (Haltestelle: Boltensternstr.), die Backpacker-Hostels Station in Bahnhofsnähe und Blacksheep-Hostel direkt im Kwartier Lateng und im belgischen Viertel das "Hostel für besondere Wohnerlebnisse", The housemates (Bed in a dormitory from € 21.50). Centrally located on the Cologne Ring, the Pension Otto as an overnight stay (room 25 - 65 €).
- 1 Youth Hostel Pathpoint-Cologne - Backpacker Hostel, Allerheiligenstrasse 15, 50668 Cologne. Tel.: 49(0)221 13 05 68 6-0, Fax: 49 (0)221 13 05 68 6-70, Email: [email protected].
- 2 A&O Hotel Cologne-Dom, Komödienstraße 19-21, 50667 Cologne. Tel.: 49 (0)221 46 70 6 - 47 00. Inexpensive hotel directly at the cathedral.
- 3 A&O Hotel and Hostel Cologne-Neumarkt, Mauritiuswall 64/66, 50676 Cologne. Tel.: 49 (0)221 46 70 6 - 47 00. Price: beds in multiple rooms from € 8.
- 4 A&O Hotel and Hostel Cologne Central Station, Ursulaplatz 10-12. Tel.: 49(0)221 4993 7050, Email: [email protected].
medium
If you want to go to a party, you should visit the Artisthotel MonteCristo settle down. In addition to the reasonably priced rooms (from € 49), the late checkout at 5 p.m. is particularly worth mentioning.
Upscale
The hotels are here with the appropriate ambience Cathedral Hotel, Excelsior Hotel Ernst, Hotel in the water tower, Hilton Cologne, Hyatt Regency Cologne and Maritime hotel to mention.
Bed and breakfast
If you don't want to stay in a hotel, Cologne has many guest rooms and holiday apartments. These accommodations are usually the only available accommodations in Cologne, especially during trade fairs.
- Apartment in Cologne. Inexpensive apartment in Cologne.Feature: pension.
Learn
The first Cologne University was founded in 1388, making it one of the oldest universities in Germany. In the Middle Ages, numerous scholars of international standing taught at it, such as Albertus Magnus, after whom today's university is named. The university was closed by the French and it was only reopened after World War I. In addition to the university, numerous other universities have emerged in Cologne in recent decades.
University of Cologne - The university, re-established in 1919 by Konrad Adenauer, is the largest university in Germany and offers a wide range of subjects with a focus on the humanities and medical subjects. It is located in the south-west of Cologne and can be reached via the Köln-Süd train station or the Universität Stadtbahn stop. The core of the university is on the left and right of Universitätsstrasse. A "student path" leads from the city center via the university campus to the university clinic, characterized by the ward block, in Lindenthal. In the 2005 summer semester there were a total of 47,200 students, more than 10% of them from abroad. The Faculty of Philosophy provides the largest share with over 15,000 students, followed by the Faculty of Economics and Social Sciences with almost 9,000 students.
Technical University of Cologne - The former university of applied sciences was renamed to a technical university in September 2015, whereby the new name only describes some of the courses. In addition to various technical directions (e.g. mechanical engineering, computer science, architecture), social and economic subjects can also be studied here. The TH has two centers: one is in Deutz, the other in the southern part of the city between Chlodwigplatz and the banks of the Rhine. Around 24,000 students study at it.
German sports university - The sports university, located next to the stadium area in Cologne-Müngersdorf, is attended by almost 6,000 students. In addition to teacher training courses, numerous areas of sport are researched and taught there, such as training methods, sports medicine and doping analyzes.
University of Music and Dance - With almost 1,600 students, it is the largest music college in Germany. Almost all common musical instruments, singing and dance are taught. The university is located in the northern old town near Eigelstein and Ebertplatz.
Catholic college - This is the amalgamation of four Catholic universities of applied sciences in North Rhine-Westphalia. The head office is at the largest location in Cologne, more precisely in the northern part of the city near Reichenspergerplatz. Around 3,000 students are enrolled in the two faculties of social sciences and nursing sciences.
Art college for media - This state university with around 300 students emerged from the former Werkkunstschule. In the media city of Cologne her focus is not on painting and sculpture, but on media art, i.e. film, video, sound art and photography.
In addition to the universities mentioned above, there are also several private universities whose courses are mostly in the field of economics or the media.
Work
The largest industrial employers in Cologne are undoubtedly the Ford plants, which have been manufacturing in Cologne-Niehl since 1931. Another industrial focus is the Cologne chemical belt. In the north and south of the city - partly also beyond the city limits - there are several companies in the chemical industry. These include well-known large corporations such as Degussa, Shell, Hoechst and Bayer. Almost half of the Bayer factories in Leverkusen are located in the city of Cologne, and the city limits of the Dormagen Chemical Park also run across the factory premises. The chemical company Lanxess, which has been spun off from the Bayer Group, has its headquarters in Cologne. Other branches of industry have largely disappeared in the last few decades: The formerly important engine manufacturer Deutz AG - after all the inventor of the gasoline engine - has shrunk considerably in the last few decades and the once large cable manufacturers are almost no longer available. Railways, cable cars and lighthouse lights are no longer built in Cologne either.
The largest institutional employer with over 6,500 employees is the University of Cologne Clinic. The other universities also offer numerous jobs in teaching, research and administration. WDR is Europe's largest broadcaster and has its main building in the heart of the city. Another building block of the media city of Cologne is Germany's largest private broadcaster RTL. Deutschlandradio, as a federally owned broadcaster, also has its headquarters in Cologne. Other private-sector broadcasters based in Cologne are VOX, NTV and Terranova and, of course, diverse companies that do their work around the international TV center in Cologne. The media also includes the press group DuMont-Schauberg, which not only publishes all of Cologne's daily newspapers, but has also taken over other newspapers.
Another focal point in the world of work is the insurance industry with the original Cologne insurance companies Agrippina and Colonia, which today, however, belong to the international insurance groups of the Züricher Group and Axa. After Munich, Cologne is the second power in the country with around 60 main administrative offices, led by Gerling, DKV and Gothaer. Every twelfth employee in the insurance industry in Germany works in Cologne. Deutsche Lufthansa AG is the only DAX company headquartered in Cologne and employs several thousand people there (including subsidiaries). Other major employers are public administrations and courts. In addition to the city administration, Cologne is home to the Federal Administration Office, the district government and the headquarters of the Rhineland Regional Council.
security
Organized serial thefts are a massive security problem in the city on the Rhine. There are 12,000 crimes in Cologne every year, 5,000 more than in 2007.
Otherwise, the safety instructions (in full trams, at the stops and at the main train station; pickpockets) do not differ from other German cities. Nevertheless, one should always be a little vigilant.
Particular care is to be taken during Carnival time (the fifth season) when the fools (Tease) occupy the streets and pubs. Then there is a lot of alcohol involved and unfortunately one or the other aggression.
health
Wellness and relaxation can be found in the Claudius thermal baths, the Mauritius-Therme, the quite new Neptunbad and the public bathing establishments Agrippabad and Müngersdorfer Stadion. The green belt around Cologne offers designated jogging paths.
Cologne has numerous clinics of various sizes that cover the entire city area. Resident specialists from all specialist areas with an emergency medical service as well as pharmacies with night service are available.
- a selection of medical and dental emergency services in Cologne
- Dental emergency service Cologne mediated by A&V e.V. (only mediates to affiliated doctors): 0221-29010200
Practical advice
Tourist info
- 1 Service Center & The KölnShop, Kardinal-Höffner-Platz 1 D - 50667 Cologne. Tel.: 49 (0)221 34 64 30, Email: [email protected].Service Center and KölnShop.Open: Mon - Sat 9 a.m. - 8 p.m., Sun and public holidays 10 a.m. - 5 p.m.
news
On the radio
- Public service: WDR 2 (frequency 100.4 or 98.6), hourly; Traffic news every half hour during the day, otherwise every hour
- Private: Radio Cologne (frequency 107.1), every half hour during the day, otherwise every hour, traffic reports and news
On TV
- Public law: WDR: Current hour (all of North Rhine-Westphalia) 6:45 p.m., local time from Cologne (Cologne and the surrounding area) 7:30 p.m. The local time from Cologne can only be received in Cologne and the surrounding area.
Church services
Holy masses in Catholic churches near the main train station:
- Dom, Domkloster 3 (next to the main train station). Cologne cathedral Sun: 7:00 am, 8:00 am, 9:00 am, 10:00 am, 12:00 pm, 5:00 pm, 6:30 pm; Mon-Sat: 6:30 a.m., 7:15 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 6:30 p.m.
- St. Andrew, Komödienstr. 8th. Saint Andrew Sun: 9:00 a.m., 11:00 a.m., 6:00 p.m. Mon-Fri: 12:05 p.m.; Sa: 9:00 a.m., 5:00 p.m.
- St. Mary of the Assumption, Marzellenstr. 26th Saint Mary of the Assumption Sun: 11:00 a.m.; Wed, Thu: 10:30 a.m.; Sa: 5:00 p.m., 6:30 p.m.
- Minorite Church, Kolpingplatz 5. Sun: 9:00 am, 11:00 am, 4:00 pm; Tue-Fri: 9:00 a.m.
The main Evangelical Church of Cologne is the Antoniterkirche on Schildergasse. Church services Sun 10:00 am and 6:00 pm. From Monday to Friday there is a 10-minute prayer at 6:00 p.m. Next to the church there is an information point that provides information about the Protestant churches and institutions in the greater Cologne area (opening times: Mon-Sat 12:00 p.m. - 4:00 p.m.).
miscellaneous
All four German cell phone networks are also easily available in Cologne in the subway. There are internet cafés where there is usually more activity - most likely in the nightlife districts described above.
Hotspot areas on Open Street Map (City of Cologne site)
trips
Generally
Within an hour with public. Means of transport - If you don't want to travel far, you can reach the neighboring cities in 20-30 minutes Dusseldorf, Wuppertal or Bonn reach and also after Aachen it's only about 50 minutes. If you prefer the countryside, you can find it with the Middle Rhine Valley, the Eifel, the Siebengebirge or even that Bergisches Land Recreational areas right at the gates of Cologne. The extensive Königsforst forest and the Wahner Heide in the southeast of the city are even closer. In summer there are numerous swimming lakes, including the Fühlinger See in the north of Cologne.
- It is also a beautiful bathing lake Bleibtreusee in Brühl - a recultivated former lignite opencast mine - which enables free bathing fun (around a kilometer walk) in summer. There is also a water ski facility here. (Address (with parking facilities): Bleibtreuseeweg, arrival by bus and train: line 18 to (H) Hürth-Hermülheim, then line 979 (towards Erftstadt, Zülpich) to (H) Heide Abzw. Or line 18 to (H) Brühl Mitte , then either line 990 (towards Erftstadt) to (H) Freiheitsstraße, lines 701 or 702 to (H) Heide Schule) or line SB 93 (towards Kerpen) to (H) Freiheitsstraße. Alternatively, RE 5, RB 26, RB 48 to Brühl station, then line SB 91 (direction Dormagen) to (H) Freiheitsstraße. (Tickets from Cologne: price level 2b)
Excursions in the area
- Koenigswinter - An excursion that is also interesting for children: take the train (RE 8 & RB 27) to Königswinter, then "climb" the Drachenfels on foot or with the cogwheel train. At the top there is a good view as far as Cologne, the ruins of Drachenfels Castle, and for the hungry there is also a cafe / restaurant. Then there are three options to choose from:
Option 1: With the Drachenfelsbahn to the station "Schloss Drachenburg", there is the "Drachenhöhle" and a reptile zoo (opening times: 15.03 - 1.11.). Then to the valley station.
Option 2: With the Drachenfelsbahn to the valley station, then to the Sea-Life-Aquarium. The stingray petting pool or the glass tunnel in the pool could be interesting for children.
- If you have a little more time with you, you can also use the Cologne-Düsseldorfer Rheinschiffahrt ships in one or both directions between Cologne and Königswinter in the summer. One should take into account, however, that the banks of the Rhine between Cologne and Bonn are not among the most handsome sections of the river, but are partly built on with large industrial companies. If you place more value on the landscape, you should better drive the section of the river between Bonn and Koblenz.
- You can also visit the federal city from Königswinter Bonn visit (option 3) (line 66 from Koenigswinter ferry or by ferry across the Rhine (€ 4.80, children up to 6 years free), then line 612 bis Bonn Bad Godesberg station (RE / RB / U to the center)).
(Tickets from Cologne: price level 4)
- Lookouts on Cologne - There is a beautiful viewpoint of Cologne in Bergisch Gladbach-Sand (Herkenrather Straße), at the Rochus Chapel, at these coordinates: 50.987963,7.170691 (line S 11 to Bergisch Gladbach S-Bahn, then lines 335 (destination: Lindlar / Frielingsdorf) or 453 (destination: Grünenbäumchen / Oberkülheim) to ( H) width, (tickets from Cologne: price level 2b)), as well as from the "Kölner Fenster" in Bergisch Gladbach-Walnut.
- Bonn - Former capital of the Federal Republic of Germany with excellent museums, a beautiful old town and student flair. 10 minutes by long-distance trains, 20 minutes by regional train and around 60 minutes by tram (tickets from Cologne: price level 4)
- Garzweiler open-cast lignite mine - Visit to the huge pits and the excavators used in operation. By train from the main train station within 30 minutes Juchen or Hochneukirch then walk the follow the directions given (Jüchen: 5min, Hochneukirchen: 30min).
- that is a little closer Hambach opencast mine - with the information center : terra nova and a view over and into the open pit. Arriving by car via the A4 in the direction of Aachen, exit Elsdorf 7b on the B477 in the direction of Bergheim, then follow the signs, by bus & train: RE 9 / S 12 / S 19 direction Aachen Central Station, Sindorf or Düren to Horror, then bus 941 in the direction of travel Elsdorf to (H) Berrendorf village square, then a 10-15 minute walk (Kerpener Straße heading south) or RB 38 bis Bergheim, then bus 950 in the direction of travel Elsdorf to (H) Berrendorf village square. Since the bus connections can be different or irregular, in case of doubt here make sure.
Tickets from Cologne: price level 4 - the Aggertal cave (Thu - Sun, 10 a.m. - 5 p.m., guided tours from 10 a.m. every 75 minutes; admission € 4.50, reduced € 3.50) in Gummersbach, by train (RB 25) to Gummersbach or Ründeroth, then bus 317 to (H) Aggertalhöhle. (Tickets from Cologne: price level 4)
- Zülpich with the Museum of Bathing Culture - includes, among other things, the excavation of a well-preserved Roman thermal baths - as well as the former State Garden Show 2014 (Entry 4 €). Arriving by car: A1 to exit 110 towards B56n (Zuelpich), follow the signs on site, by train: it is best to use the timetable information, Destination: (H) Frankengraben, Bonner Straße / Zentrum or Römerbad, approx. 1 km from the nearest train station in Zülpich, depending on the connection, you can save money (then you only need price level 4 instead of price level 5 for the tickets, the corresponding price level is indicated under the respective connection).
- The Altenberg Cathedral is a former monastery church of the no longer existing Altenberg Abbey (Cistercian). The church was built from 1255 to 1379. The monastery was dissolved and plundered in the course of the secularization in the 19th century, the buildings then fell into disrepair over time, but were rebuilt - later with support from the Prussian state - until 1857 and have since been used jointly by both denominations. Arrival by bus and train: RE 1, RE 5 or S 6 to (H) Leverkusen Mitte, then bus line 212 in the direction of Odenthal to (H) Altenberg // on weekends also S 11 to Bergisch Gladbach, then line 432 directly to Altenberg. (Tickets from Cologne: price level 3) Arrival by car: A1 to Burscheid exit (97), then signs for Altenberg or from Cologne-Mülheim via Berliner Straße and Odenthaler Straße on to Altenberger-Dom-Straße.
- Bruehl - Castles of Augustusburg and Falkenlust (Unesco World Heritage) and amusement park Phantasialand (Tickets from Cologne: price level 2b)
- Brauweiler Abbey - one of the great Romanesque church buildings in the Rhineland. Directions: S12 / S 19 to (H) Frechen Königsdorf, then bus 980 (destination: Sinnersdorf) to (H) Brauweiler Abbey, S 12 / S 19 to Cologne-Lövenich or tram line 1 to Weiden Zentrum, then bus 949 to ( H) Brauweiler Abbey, RE 8 / RB 27 to (H) Pulheim, then bus 980 (destination: Frechen) to (H) Brauweiler Abbey. (Tickets from Cologne: price level 2b)
hitchhiking south - To hitchhike to the south, the distribution circle south is suitable - this is where the traffic for the autobahn gathers and there is a petrol station. Bus 132 from Breslauer Platz / Hbf via Chlodwigplatz, get off at the "Arnoldshöhe" stop and then a few more steps in the direction of travel.

Drachenfels
.jpg/120px-Bonn_-_Altes_Rathaus_am_Markt_(tone-mapping,_retouched).jpg)
Old town Bonn

Hambach opencast mine

Aggertal cave
Museum of Bathing Culture Zülpich

Altenberg Cathedral

Augustusburg Castle in Brühl

Phantasialand

Zons

Brauweiler Abbey
Excursions by bike
- Leverkusen: Bayer plant, former State horticultural show, 13 km between the city centers, flat
- Bonn: Federal city, old town, 33 km between the city centers, largely flat, in Bonn it is hilly.
- Bruehl: Phantasialand, 18 km from Cologne city center, slight incline, sloping on the way back.
- Erftstadt: Bathing lakes, 25 km, slight incline, sloping on the way back.
- Dormagen: Knechtsteden Monastery, 22 km, largely flat
- Zons: Well-preserved, medieval building stock - especially complete city wall with mill tower, from which one has a very nice overview, 26 km, largely flat
See also:
- Bike tours in and around Cologne on the city side
- Adventure routes in the regional green corridors. For information see official site for the green corridors
- Bike routes and tour suggestions in Rhineland Nature Park with map, GPS data and route descriptions (click on the individual logos).
literature
Web links
- http://www.stadt-koeln.de - Official website of Cologne
- Cologne tourism - official tourism website • Worth seeing in Cologne
- alternative official tourism site
- Kölnwiki - City wiki for Cologne
- Cologne dialect: Academy for us Cologne language with dictionary and vocabulary trainer
- City tour Cologne - Historical & thematic tours through Cologne
- Culinary city tours Cologne - Enjoyment tours with Cologne history (s) and food
WebCams
- WDR DomCam on the Cologne landmark. The image is updated every 60 seconds.
- Webcams in Cologne on koeln.de. All webcams in the city are listed here, and the preview images are also updated regularly.
- Live webcam Cologne Heumarkt swings from the cathedral to the 3 crane houses on the banks of the Rhine.
Individual evidence
- ↑Jürgen Heinen: Climbing guide Hohenzollern Bridge. (PDF 2.1 MB)
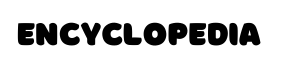




.jpg/350px-Bahnhofsgebäude_Köln_Messe_Deutz_-_Gesamtansicht_(4416-18).jpg)











.jpg/160px-KölnTriangle_(0684).jpg)




.jpg/350px-Römisch-Germanisches_Museum_Köln_(2514-16).jpg)



.jpg/350px-Museum_für_ostasiatische_Kunst_(0480-82).jpg)
.jpg/350px-Kulturquartier_Köln_-_Rautenstrauch-Joest-Museum_-_Vorderseite_(6904-06).jpg)


.jpg/350px-Rheinauhafen_-_Sport-_und_Olympiamuseum_-_Rheinseite_(8722-24).jpg)

.jpg/350px-Odysseum_Gesamtansicht_(9633).jpg)
.jpg/350px-Oper_Köln_(4202-04).jpg)
.jpg/350px-Musical_Dome_Gesamtansicht_(9300-02).jpg)





.jpg/120px-Bonn_-_Altes_Rathaus_am_Markt_(tone-mapping,_retouched).jpg)







